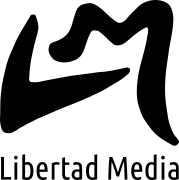Der amerikanische Traum - das kapitalistische Aufstiegsversprechen schlechthin - erscheint unausrottbar. Die Literatur kennt jedoch Auswege aus der falschen Nostalgie. Bild: Annie Spratt/Unsplash
Die Kolumne „Klassisch subversiv“ ist ein Versuch in politischem Eskapismus – eine Würdigung von Büchern aus der Vergangenheit, die immer noch klüger, kritischer und gewitzter sind als unsere verlogene Gegenwart. Im ersten Artikel der Reihe ging es um Stefan Heyms Roman Ahasver.
Die Debatte um die junge Afroamerikanerin Amanda Gorman und das Gedicht, das sie zur Amtseinführung Joe Bidens vortragen durfte, ist für Feuilletonist*innen unwiderstehlich. Was selbstredend nichts mit den Qualitäten dieses Textes zu tun hat, sondern hierzulande vielmehr mit dem „Sorgenkind USA“ und dem Bedürfnis, die transatlantische Partnerschaft auch kulturell weiter aufzurüsten. Kurz nachdem Gorman mit ihrer flammenden Rede die Herzen westlicher Linksliberaler auf dem ganzen Globus für sich erobert hatte, entbrannte eine Debatte um die Übersetzung des Spoken-Word-Gedichts. Eine Übersetzer*in sehe sich schließlich mit der Aufgabe konfrontiert, „den Erfahrungswelten, dem Wissen über geschichtliche Aufarbeitung, Debatten über Wortgebräuche und dem Selbstverständnis von Nachkommen einst Versklavter und Kolonialisierter“ Rechnung zu tragen, schrieb Hadija Haruna-Oelker, eine Autorin der letztlich gemischt rezipierten Übersetzung im Freitag. Die Anspielungsflut des Slam-Gedichts scheint derweil jedoch das Einzige zu sein, das den Text einer afroamerikanischen Tradition zugehörig macht. Der affirmative Inhalt, der die Erfahrungen indigener Amerikaner*innen verhöhnt und unterstellt, die von Sklaverei, Völkermord und Krieg geprägte Geschichte der USA gelte es zu „reparieren“, um die große Versöhnung zu realisieren, scheint in der Abwägung keinerlei Rolle gespielt zu haben, in welcher Tradition der Text wirklich steht.
Die schlechte Nachricht zuerst: Alles, was Gorman in ihrer Karriere nun noch blüht, wird sie in ihrer Überzeugung wohl bestätigen, sie lebe wirklich im „land of opportunity“, ungeachtet der Tatsache, dass dort heute mehr Schwarze hinter Gittern sitzen als zur Zeit der Sklaverei in Ketten lagen. Aber jetzt die gute Nachricht: Wir Leser*innen müssen uns diese binnengereimten Verklärungen des Status quo und vagen Visionen besserer Tage, die die Hamilton-Generation produziert, gar nicht weiter antun. (Es sei denn, wir entscheiden uns aus irgendeinem Grund dazu, einen Artikel darüber zu schreiben…)
Die Kraft der Negation
Das Amerika, in dem gesellschaftliche „Spaltung“ nicht allein von einem rechten Demagogen gesät wird, sondern überhaupt erst auf dem Boden von Entfremdung und Deklassierung gedeihen kann, ist nicht weit. Dieses „andere“ Amerika, in dem die tödliche Ideologie des Weißseins nicht als das Werk eines putschfreudigen Disney-Bösewichts namens Trump erscheint, sondern eine jahrhundertealte Geschichte hat, muss man jedoch jenseits der ideologischen Angebote der Biden-Administration suchen. Eine literarische Hausapotheke, die mit den Essays W.E.B. Du Bois‘ und James Baldwins bestückt ist, verfügt bereits über genügend Mittel gegen virale Versöhnungspredigten.
Ein zuversichtlicher Blick auf die „Demokratie in Amerika“, wie ihn Joe Biden bereits vor seiner Vereidigung an den Tag legte, verschleiert aber nicht nur die Natur des Rassismus, sondern auch der Klassenverhältnisse. Von der Tellerwäscherin zum CEO, von der mageren Tochter einer Schwarzen Alleinerziehenden zur Hofdichterin des Präsidenten – irgendwo haben wir das alle schon einmal gehört. Vielleicht ist gerade deshalb die literarische Kritik dieser Ideologie so gut gealtert. Aber selbst mit solcher Gegenlektüre kündigt sich noch kein Ausweg aus der Endlosschleife kollektiver Selbstempörung und daran anschließender Beschwörung des großen Neuanfangs an, die den amerikanischen Liberalismus seit Jahrzehnten kennzeichnet. Kritik, so „tried and true“ sie auch sein mag, entfaltet noch nicht die volle Kraft der Negation, solange sie sich an ihrem Ziel nur fleißig abarbeitet. Manchmal braucht es eben einen vollständigen Bruch mit dem Diskurs anstelle eines Einwands. In der amerikanischen Literaturgeschichte hat sich besonders der Dichter und Kurzgeschichtenautor Raymond Carver durch einen derartigen Bruch mit großen amerikanischen Erzählungen hervorgetan – und das bereits in den 1970er Jahren.
Nicht „battered and beautiful“ – einfach „battered“
Raymond Carvers Kurzgeschichten gelten als Musterbeispiele des literarischen Minimalismus und werden daher häufig in einem Atemzug mit denen Ernest Hemingways genannt, der die Erzählkunst mit einem Eisberg verglich: eine ungeschmückte Textoberfläche, die über einen gewaltigen, von der Betrachter*in höchstens erahnbaren Unterbau verfügt. Bei der stilistischen Bereinigung von Carvers Stories spielte sein inzwischen berüchtigter Lektor Gordon Lish eine wichtige Rolle – ob eine unrühmliche oder nicht, spaltet die Kritik bis heute. Neben der Sprache muten jedoch auch die Lebenswelten von Carvers Charakteren „einfach“ an – allerdings nicht, weil diese besonders aufgeräumt wären. Bevölkert werden seine Geschichten von lethargischen Arbeitslosen und gehetzten Arbeitenden, die ihrer Prekarität nicht entrinnen können, von trauernden Eltern und entzweiten Ehepaaren. Carvers Protagonist*innen sind enttäuscht bis abgeklärt, oft voller Ressentiments, und doch mindestens empathiefähig. Sie sind nicht „battered and beautiful“, sondern einfach „battered“ – niedergeschlagen.
Obwohl Carver über die amerikanische Arbeiter*innenklasse schrieb, zeichnete er in vielen Erzählungen eine Welt nach, in der es den amerikanischen Traum genauso gut nie hätte gegeben haben können. Das Elend dieser Klasse ist nicht das Ergebnis eines wirtschaftlichen Schocks, der einen ideologisch unterfütterten Fortschrittsoptimismus plötzlich als trügerisch entlarvt. Das wäre Kritik. Nein, das Elend ist banaler Alltag, es macht sich nicht einmal als solches bemerkbar. Rezession ist nicht länger ein Ereignis, sondern längst zur Lebensform geworden. Arbeitsmoral existiert höchstens noch als probates Mittel, sich von der Beschäftigung mit inneren Angelegenheiten fernzuhalten. Die Ehe taugt nichts, aber das weckt noch keinen Gedanken an mögliche Alternativen. Psychische und materielle Entbehrungen wirken umso selbstverständlicher, weil Carvers Erzähler*innen nicht politisieren. Sie schildern auch keine Ausbeutung im eigentlichen Sinn, sondern bilden nur deren Abfallprodukt und zugleich wichtigste Ressource ab – das spätkapitalistische Subjekt. Die Normalität, in der es gefangen ist, hat etwas Unheimliches. Gelegentlich kann eine Begegnung auch Trost spenden, für einen kurzen Augenblick.
Ein „Knacks“ im Mondlicht
Die erdrückende Zwischenmenschlichkeit in Carvers Geschichten zeichnet sich durch Szenen aus, in denen es jenseits eines Blickes, einer Geste, einer kurzen Bemerkung und der Inneneinrichtung, die alle umgibt, kaum Nennenswertes gibt. Enttäuschte Geltungsbedürfnisse, sexuelle Frustration und fehlende Anteilnahme an der Gefühlswelt anderer bilden den Unterbau der unscheinbaren Textoberfläche. Manchmal führt ein vermeintlich trivialer Zwischenfall zu einer nicht näher bestimmten Erkenntnis oder Vorahnung, das war‘s dann aber auch.
Etwa so: Eine Frau wird vom Öffnen ihres Gartentors geweckt. Sie liegt schlaflos im Bett, ihr Mann atmet laut und nimmt den Großteil der Matratze ein. Sie geht hinaus in den Mondlicht-getränkten Garten und hält einen kurzen Plausch mit ihrem Nachbarn, der gerade dabei ist, Insektizid gegen nachtaktive Nacktschnecken in seinem Garten zu verteilen. Das sei gerade genug, um die Plage nicht überhandnehmen zu lassen. Ein Zaun trennt die zwei Grundstücke, seitdem sich der Nachbar und ihr Mann einmal betrunken in die Haare gekriegt hatten. Nach dem Tod seiner Frau hatte der Nachbar bald wieder geheiratet, noch einmal ein Kind bekommen, „all in the space of no time at all“. Nachdem die Frau dem Nachbarn versprochen hat, ihren Mann von ihm zu grüßen, kehrt sie ins Bett zurück. Die Schluckgeräusche ihres immer noch tief und fest schlafenden Mannes erinnern sie an die Schnecken. Daraufhin endet die Geschichte abrupt.
Carvers Erzählungen sind ein literarisches Beispiel für das, was Roger Willemsen einmal als „Knacks“ bezeichnete: ein langsamer Verfall, der nicht auf einen plötzlichen Einschnitt zurückzuführen ist, sondern sich erst im melancholischen Rückblick offenbart. Die Einsicht, dass sich ein Kuss nicht mehr so anfühlt, wie er sich einst anfühlte oder anfühlen „sollte“, legt einen Riss frei, dessen Ursprung nicht genau festzumachen ist. Auch ein Versprechen, das einst Hoffnungen auf Glück und Wohlstand wecken konnte, wirkt weniger verraten als verwittert.
Zu Beginn der oben genannten Geschichte beschreibt die schlaflose Erzählerin den Blick aus ihrem Fenster. Dank des hellen Mondlichts kann sie die winzigsten Details ihrer Umgebung selbst zu später Stunde noch ausmachen. „It was a white moon covered with scars. Any damn fool could imagine a face there,“ sagt sie. Das assoziative Spiel, das sie hier verwirft, drängt sich ihr zum Schluss unweigerlich wieder auf, wenn sie die schleimige Vorstadtplage im Rachen ihres Mannes wiederzuerkennen glaubt. Auf diese Weise wird die Weigerung, einen Knacks im bürgerlichen Dasein zu artikulieren, zu dessen Artikulation. Die Verheißungen der amerikanischen „middle class“ lösen sich in Luft auf – oder eben in eine Schleimspur.
Spiegelübungen
Ein Einwand gegen mein Loblied auf Carver könnte lauten, er habe doch nur das Bestehende reproduziert, seine miesen Beziehungs-, Arbeits- und Alkoholismuserfahrungen verarbeitet. Da ist was dran. Doch braucht es in Amerika wie im Land der „sozialen Marktwirtschaft“ Literatur, die sich jeglicher falschen Nostalgie entzieht – ob Nostalgie für eine Vergangenheit, in der alles noch nicht so beschissen war, obwohl irgendwie schon Monopolkapitalismus herrschte, oder für eine Gegenwart, in der alles doch hätte so viel schlimmer kommen können. Dadurch, dass uns die Entfremdung und die dünn maskierte Verwundbarkeit von Carvers Charakteren so bekannt vorkommen, können seine Geschichten gleich beides kurieren. Und selbst in seinen wortkargen Dialogen, die nicht deuten wollen und um Probleme meist nur herumreden, sehen wir uns, die aus den unermüdlich bedienten Aufstiegsnarrativen herausgefallen sind, nicht nur gespiegelt, sondern auch verstanden. Die Banalität der Unterwerfung hat beinahe etwas Kathartisches.
(pj)