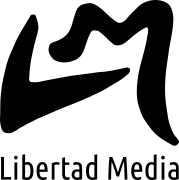„Klassisch subversiv“ ist eine Kolumne über Bücher aus der Vergangenheit, die noch immer klüger, kritischer und gewitzter sind als unsere verlogene Gegenwart. Im letzten Artikel der Reihe ging es um Kurt Fassmanns Lyriksammlung Gedichte gegen den Krieg. Der folgende Text entstand zum 32. Tag der Deutschen Einheit.
Das Einzige, was die öffentliche Debatte um den Tag der Deutschen Einheit an kollektiver Verkrampfung und Phrasendrescherei noch übertreffen kann, ist eine Debatte um die Debatte um den Tag der Deutschen Einheit. Aber da müssen wir jetzt durch.
Im Fokus linker Erinnerung an die „Wende“ steht seit Langem der Bruch zwischen Herbst und Winter 1989, als die „Wir-sind-das-Volk“-Rufe der in Leipzig und anderswo in der DDR versammelten Massen in einen Einheitstaumel umschlugen, der die Parole „Wir sind ein Volk“ stattdessen Karriere machen ließ. Dass dem deutschen Wort „Volk“ das Ideal der demokratischen Volkssouveränität heute ferner ist als seine völkische Blut-und-Boden-Deutung, erscheint uns als Produkt eines unentrinnbaren Nationalcharakters, der sich durch die Geschichte der Neuzeit zieht. Rückblickend möchte man den schnellen Verfall der DDR-Bürgerrechtsbewegung als unvermeidbar betrachten, waren doch schon die liberalen Kräfte des 19. Jahrhunderts den Reaktionären unterlegen und hatten ihre Idee einer deutschen „Kulturnation“ letztlich nur in einem preußischen Obrigkeitsstaat verwirklicht sehen dürfen. Nichts mit Demokratie.
Nach dieser Lesart wirkt die nationale Vereinnahmung der Rufe nach einem demokratischen Sozialismus wie der letzte Beweis des deutschen Sonderwegs. Die Wendung der Wende hin zum Anschluss an die BRD stützte sich aber nicht nur auf den Unmut der DDR-Bürger*innen; sie war auch eine vom Westen gewollte, die die Bundesregierung unter Helmut Kohl befürwortete und entsprechend befeuerte. Die Rechnung ging prächtig auf.
Nachher weiß man‘s immer besser
Die Geschichte dieser Vereinigung von Ost und West, die sich schnell als Geschichte der Befreiung des Kapitals und des deutschen Nationalstolzes entpuppte, wirkt rückblickend umso natürlicher, wenn man sich von dem zum Ritual geronnenen Einheitstaumel dumm machen lässt, der dieser Tage wieder durch die Massenmedien rauscht. Bei Linken führt dieses Theater dazu, dass man der Versuchung allzu schnell erliegt, den Verlauf der Geschichte zwar für falsch, aber folgerichtig zu halten: Es wuchs da wirklich zusammen, was zusammen gehörte – da haben wir den Salat, die Soljanka, whatever.
Man könnte mit dem bissigen Wolfgang Pohrt sogar meinen, „das Gebrüll der Ossis“ sei damals „Betrug gewesen“, denn „im Ostblock die Reichsten zu sein war ihnen nicht genug“. So ein Zynismus beraubt die Geschichte aber der Kontingenz, die sie trotz allen lähmenden Zwängen behält, solange sie noch Gegenwart ist. War es denn nicht der schon damals eigentlich ausgeträumte Traum einer Gesellschaft ohne Bevormundung, Abzocke und Ausbeutung gewesen, der viele Menschen anfangs zum Protest auf die Straße trieb? Deuten wir die Wende heute zu sehr von ihrem Ausgang her?
Der Moment, in dem sich Geschichte „ereignet“, ist nicht nur um seiner Unabgeschlossenheit willen wertvoll. Besonders Nachgeborene wie ich profitieren von Stimmen, die solchen Momenten zugewandt sind, ein Gespür für Zwischentöne und für die Launen der Menschen haben, ohne sie gleich geschichtlichen Notwendigkeiten unterzuordnen. Dafür braucht es Protokolle. Augenzeugenberichte. Besser noch: literarische Schnappschüsse. Ein Abgleiten ins Subjektive oder Verkürzende ist da keineswegs verkehrt. Der sächsische Dichter Thomas Rosenlöcher hat ein solches literarisches Protokoll zur Wende seinerzeit vorgelegt. Sein Dresdener Tagebuch erschien 1990 unter dem Titel Die verkauften Pflastersteine mit knapp über 100 Seiten, dieses Jahr brachte es der Suhrkamp-Verlag nach dem Tod des Autors neu heraus. Beginnend am 8. September 1989 zeichnet Rosenlöcher darin sporadisch-episodisch „das Ende des Dreibuchstabenlandes“ nach, wie er die Deutsche Demokratische Republik nennt.
„De Freiheid is ja immor de Haubtsache“
Es liegt etwas Erschöpftes und zugleich Mahnendes im Ton von Thomas Rosenlöcher, aber er begreift sich nicht als prüfenden Intellektuellen, der nur auf einen bestimmten Ausgang der Unruhen in den Köpfen und Straßen zu wetten hat. Er ist sich bewusst, dass es hier auch um ihn selbst geht. Dank des Mediums, in dem er schreibt, behalten die geschilderten Szenen Bedächtigkeit und Intimität selbst dort, wo sie auf der großen politischen Bühne spielen. „Wenn wir die plötzlich gewonnene Leichtigkeit nicht doch noch bezahlen müßten: Es wäre wider die Unvernunft der Geschichte,“ notiert er ausgerechnet am 8. November 1989.
Zuvor hat er sich auf Montagsdemos herumgetrieben und dort Eindrücke gesammelt. In seinen knappen Tagebucheinträgen ist das Geschehen immer gebrochen durch das Prisma eines Beobachters, der sich selbst zu den murrenden Mitläufer*innen zählt, von denen die DDR so viele hatte. Die gleiche bequeme Fratze erkennt er auch in denen wieder, die es sich äußerst unbequem gemacht haben, um aus der DDR auszureisen. Am 12. September hört Rosenlöcher Westradio:
Übertrittsinterviews: ‚Warum haben Sie die DDR verlassen?’ ‚De Freiheid is ja immor de Haubtsache.’ Sprachlosigkeit. Oft wird, genauso wie zu Hause, sofort das Erwartete geliefert. Derselbe Mann wäre zu Hause vor einem Mikrofon gewiß unverzüglich ins Funktionärische verfallen.
Die hier anklingende Kritik ist keine eifersüchtige Projektion eines „Hiergebliebenen“, sondern schwenkt in Selbstkritik um:
Nicht nur die Funktionäre haben sich diesen Staat verdient, auch wir, zumindest haben wir ihn hingenommen. Allein daß ich studiert habe, zeigt, daß ich ein Lügner bin. Wäre ich kein Lügner, hätte ich nicht studieren dürfen. Freilich, meine verteufelte sächsische Höflichkeit.
Rosenlöcher ist nicht, wie man vielleicht erwarten würde, hin- und hergerissen zwischen Apologie und Abrechnung mit der DDR, sondern scheint die politische Pose zumindest für den Augenblick (diesen politisch doch so kostbaren Augenblick!) für überflüssig zu halten. Die DDR ist für ihn „das doch eigentlich auch sanfte Zwangssystem“, das sich auf viel Duckmäusertum verlassen konnte, um überhaupt so lange in dieser Form durchgehalten zu haben. Er verzichtet jedoch nicht darauf, die Absurdität staatlicher Repressionen vorzuführen oder sich über Honecker-Zögling Egon Krenz lustig zu machen, dessen „Kaderwelsch zur Kirchentonart mutiert“, wenn er das aufsässige Volk mit mäßigenden Worten anspricht.
Die Kombination von Verdichtung und Zerstreuung macht den Lesegenuss von Rosenlöchers Tagebuch aus. So muss auch nicht jedes Wort ins Verhältnis zur Politik gesetzt werden, gleitet der Autor immer wieder ab in Gedanken zur Kunst, in Aphoristisches und Alltägliches. Er rekapituliert Gespräche, die „das Eingemachte der Macht“, um das es hier ihm zufolge doch geht, allenfalls streifen, die keinerlei Beitrag zur Inventur des ostdeutschen Geisteslebens um 1989 leisten. Sowieso ist das Schreiben für Rosenlöcher „vorsätzliche Täuschung“. Jede, die gerne liest, erkennt darin sofort die besondere Stärke und Schwäche der Literatur. Diese Stärke weiß Rosenlöcher auch dort unter Beweis zu stellen, wo er über die ersten Reisen gen Westen schreibt, die er nach dem Mauerfall unternimmt. 17. November 1989, auf der Fahrt nach Freiburg:
Hinter Hof die ersten Sauberkeitsdörfer. Selbst die Wiesen scheinen plötzlich von viel tieferem Grün. Aber die Kinder quengeln: ‚Wann sind wir endlich im Westen?’ Feierlich erkläre ich, daß dies der Westen sei. Eine Weile schauen die Kinder hinaus. Dann aber – ‚Das soll der Westen sein?’ – wenden sie sich lieber wieder dem hervorragend am Bart zupfbaren Verfasser dieser Zeilen zu.
Bald darauf folgt die Entfremdung von der westdeutschen Konsumhölle, wie sie dem Bundesbürger des 21. Jahrhunderts zur zweiten Natur geworden ist. „Wer die Buntheit des Westens will, wird die Verzweiflung des Westens kriegen,“ wird der junge Schriftsteller Ronald M. Schernikau, der ’89 den umgekehrten Weg antritt, im Folgejahr feststellen. Die satt und gepudert dreinschauenden Gestalten, denen Rosenlöcher im Westen begegnet, regen ihn zum Nachdenken an. Über die laut proklamierten Vorzüge des freiheitlichen Systems und über das Verhältnis, das die Deutschen hüben und drüben zu ihrer Gegenwart haben. Er gesteht seinen Landsleuten dank ihrer gestohlenen Gegenwart „den Vorteil einer, wenn auch geduckten, Renitenz“ zu, der sie zu Realistinnen statt Selbstdarstellern gemacht hat.
Ein Land als „Konkursmasse“
Im Dezember jenes schicksalhaften Jahres erproben Rosenlöchers Landsleute dann eine „neuere Methode, auf die alte Art Deutschland zu rufen,“ wie es in einer der Miniaturen heißt. Demobesuch in Dresden am 4. Dezember: „Deutschland als Knüppelwort.“ Hier verfinstert sich das Bild, das der Autor von der aufsteigenden Nation zeichnet, aber ohne dass seine Sorge um das Schicksal der hasserfüllten Menschen verstummt. „Auch mich läßt nun der Zeitgeist spüren, daß dieses Land längst ist, was ich mit jedem Jahr deutlicher kommen sah und zuletzt doch noch für verhinderbar hielt: Konkursmasse.“ Sein Blick weitet sich wieder auf die vielen Fahnen und Plakate der auf dem Dresdener Theaterplatz versammelten Volksmassen:
Allenthalben Honeckerbilder: Honecker, hinter Gitter. Honecker im Sträflingsanzug. Honecker mit säuberlich aufgemalter Gefängnismütze: Aber so richtig lachen kann ich nicht, denn schließlich war er schon im Gefängnis gewesen, als unsere Eltern noch den Hitlergruß übten.
Um die Geburtswehen dieser spätkapitalistischen Gesellschaft einzufangen, war Thomas Rosenlöcher nicht auf die klare politische Stellungnahme angewiesen, die man von Intellektuellen gemeinhin erwartet. Rosenlöchers Haltung wurzelte stattdessen in den Tugenden des Dichterhandwerks: in der genauen Beobachtung und einer fast zwanghaften Zuspitzung der Ereignisse. Dass er in der Schriftstellerei zuallererst die Täuschung sah, verleitete ihn vielleicht zu den vielen Sprachspielen, die weit bessere Pointen hergeben als sie eine Reportage leisten könnte. Die subtile Strahlkraft seiner Vorahnungen ist ohne diesen ästhetischen Ausgangspunkt kaum denkbar.
Und heute?
Heute waten wir immer noch durch die real existierende Alternativlosigkeit, in der wir den Tagebuchschreiber zu Beginn des Buches antreffen und am Ende zurücklassen müssen. Das Dreibuchstabenland, in dem er aufwuchs und ausgebildet wurde, hatte ihn zu seiner Ermattung gewissermaßen erzogen, dessen Ende schien die Grundhaltung zu bestätigen. War mit dem absehbaren Scheitern der DDR-Reformbewegung der weitere Verlauf der Geschichte – und der Erinnerung – schon abgesteckt, die DDR nicht sowieso ökonomisch am Ende? In einer der letzten Aufzeichnungen, vom Wahlabend des 18. März 1990, heißt es: „Es ist genauso gekommen, wie ich gedacht habe, und doch bin ich enttäuscht.“ Am Ende der Kontingenz steht selbst für einen Zeitzeugen oft die Resignation. Zumindest, wenn wir von der deutschen Geschichte sprechen.