
Ein Banner der Jugend gegen Rechts gegen die Stalinist*innen der FDJ. Die Veranstaltung am Samstagabend richtete sich wiederholt gegen jederlei staatliche Gewalt. Foto: Philipp Janke/Libertad Media
Jena, Samstagnachmittag um kurz nach fünf. Klarer Himmel, die Sonne brennt immer noch auf den Paradiespark herab. Im Schatten der Universaale-Gesamtschule ist es angenehmer. Dort tummeln sich mehrere kleine Gruppen Alternativer und plaudern untereinander. Daneben ein Set mit Schlagzeug und Lautsprechern. Ein paar Tische sind aufgebaut, werden mit Fahnen der Freien Arbeiter*innenunion (FAU) und einem Banner der Jugend gegen Rechts geschmückt. Hier will sich die linksradikale Szene Jenas zu einer mehrstündigen Kundgebung mit Konzert versammeln. Wer pünktlich gekommen ist, muss sich gedulden.
Nach einer Einweisung in die Hygieneauflagen meldet sich eine junge Frau für die Veranstalter*innen zu Wort, die sich später als Maria vorstellt. Sie blickt in die noch dünnen Reihen der Versammelten und witzelt: „Der Schwarze Block ist noch gar nicht angereist. Die sind wohl noch in der Innenstadt beschäftigt“ – ein Augenzwinkern an alle, die sich am Nachmittag gegen den Auftritt der stalinistischen FDJ dort gewehrt hatten. In saloppem Ton gibt Maria dann bekannt, das Motto der Kundgebung, „Linksradikales Jena – Für eine freie Stadtgesellschaft“, habe bei den Behörden für Aufregung gesorgt. „Das war natürlich auch die Absicht,“ meint sie.
Maria will sich dennoch rechtfertigen, ihrer Frustration Luft machen. Sie fragt, ob sich die Anwesenden noch an das Bild des vor ein paar Jahren ertrunkenen syrischen Jungen, Alan Kurdi, erinnern. Das erkläre eigentlich schon, warum es diese Veranstaltung gebe. Der Aufruf, eine freie Stadtgesellschaft zu schaffen, bedeute, „dass uns der Rassismus ankotzt, vor allem der staatlich gewollte. Dass es die ganze Zeit passiert, aber kaum Thema ist.“ Die Öffentlichkeit interessiere sich mehr für zerschlagene Scheiben in der Stuttgarter Innenstadt, der rassistische Normalzustand „interessiert keen‘ Menschen.“ Es sei eine gute Nachricht, dass das geplante Nazi-Tattoostudio in Jena nicht eröffnen werde, aber den Rechten in den europäischen Parlamenten sei „mit Backpfeifen leider nicht beizukommen.“
Auch die Lokalpolitik nimmt sie aus ihrer Kritik nicht aus. Sie beklagt einen „Unwillen auf Stadtebene, sich mit der Mietsituation auseinanderzusetzen“ und kritisiert die örtliche Polizei für ihre regelmäßigen Personenkontrollen an der Stadtkirche und im Paradiespark. „Das kennen die ganz Alten auch aus anderen Zeiten.“ Die Kontinuitäten des liberalen Staates mit der SED-Diktatur und die neue soziale Ungleichheit hätten System, der „Kapitalismus mit demokratischem Mäntelchen oder wie man es auch nennen will“ lasse nicht auf Verbesserungen hoffen, die von den etablierten staatlichen Institutionen ausgehen.
Für Passant*innen, die durch den Paradiespark schlendern oder radeln, wirkt die Kundgebung eher wie ein kleines Konzert: Die Punkgruppe „Dämsel in Distress“ aus Berlin macht den Anfang, es folgen die Jenaer Bands „Phoenix City Mobsters“ und zuletzt „Antisocial Antifascist“ im Wechsel mit Redebeiträgen. Die mal kurzen, mal etwas längeren Statements dominieren den Abend nicht, aber sie knüpfen dennoch einen roten Faden: Das, was Maria ironisch-bescheiden „die Minimalforderungen“ nennt – ein freies Leben für alle, ohne Bevormundung und Ausgrenzung durch staatliche Gewalt. Kurz: Anarchie.
Nach etwas holpriger Beschallung durch die „Dämsel“ tritt nun „JC“ von der Jugend gegen Rechts ans Mikrofon heran. „Wir müssen reden,“ sagt sie, und dieser erste Satz wiegt schwer in ihrem Mund. Worüber wir reden müssen? Das sei die in dieser Gesellschaft für Frauen allgegenwärtige sexuelle Gewalt. Es mache sie wütend, dass den Opfern wiederholt selbst für Belästigungen und Vergewaltigungen die Schuld gegeben werde, indem man sie zu anderem Verhalten in der Öffentlichkeit ermahnt. „Auch in linken Strukturen gibt es keinen ausreichenden safe space,“ fügt sie hinzu, weshalb es wichtig sei, auch dort „auf toxische Verhaltensweisen aufmerksam zu machen.“
Und da ist er wieder: dieser erdrückende Normalzustand, der jede Utopie in die Defensive zurückzudrängen droht. JCs Rede jedenfalls endet offensiv: Aus der Menge ruft es, „Kein Gott, kein Staat, kein Patriarchat!“
Inzwischen hat sich die Wiese gefüllt. Passend zum Motto sitzen die meisten Zuschauer*innen außerhalb der für die Versammlung vorgesehenen, mit Absperrband markierten Zone – da, wo das Gras grüner ist. Das Reggae-Konzert der Phoenix City Mobsters sorgt trotz der schweren politischen Kost für ausgelassene Stimmung. Kinder tanzen, ein Hund sprintet vorbei an den Parkbesucher*innen auf der Suche nach einem Frisbee oder Ball. Die Punks bespritzen sich gegenseitig mit einer Wasserpistole, um dessen Lauf das „Ordner“-Armband eines der Versammlungsordner*innen gewunden ist. Die Ansagen der Bands sind kaum zu verstehen, aber das kümmert keine*n.
Der dritte Redebeitrag kommt von Konstantin von der FAU. Er greift die Eindrücke der FDJ-Demonstration wieder auf. Dass die radikale Linke gegen Stalinist*innen kämpft, heiße nicht, sie mache mit der Polizei oder dem Kapital gemeinsame Sache. Im Gegenteil: Man bedenke all die sozialen Kämpfe, an denen sich die linke Szene in Jena beteilige – zum Beispiel in der FAU, dem Frauenstreikbündnis und den Mieter*innenvereinigungen. Ihm sei es dennoch wichtig, dass Menschen sich an der Universität oder an ihrem Arbeitsplatz mehr organisierten. „Es wird Zeit, dass wir da mehr Bambule machen und mit Leuten reden.“ Um Gegenmacht aus der Gesellschaft geht es ihm, deshalb widmet er sich im Anschluss der Polizeifrage.
Die Polizei stelle „nicht nur da drüben, in den USA“ ein Problem dar, ruft Konstantin den Anwesenden zu. Sich zu organisieren sei auch zur Selbstverteidigung gegen die Polizei vonnöten. Was folgt, ist ein Resümee – man möchte es kaum mit diesem hübschen Wort bezeichnen – der polizeilichen Übergriffe in Jena und ganz Thüringen innerhalb der letzten 15 Jahre. Angefangen mit einer migrantischen Demonstration gegen Polizeigewalt im Juni dieses Jahres, zu der sich Zivilpolizist*innen mit schwer zu übersehender Schusswaffe gesellten, über die Schikane gegen unser Presseteam bei einem Demozug für die Aufnahme von Geflüchteten zur Zeit der Kontaktbeschränkungen und faktisch ausgesetzten Versammlungsfreiheit. Konstantin greift eine Vergewaltigung durch Polizisten, „schikanöse Kontrollen“ von Fußballfans, die Hausdurchsuchung eines Minderjährigen, eine „Razzia“ nach dem G20-Gipfel 2017, das Errichten eines „Polizeistaatsregimes“ zum Schutz von Nazi-Kundgebungen 2015 und viele weitere Fälle auf. Es seien von polizeilicher Willkür verschiedene Leute betroffen, vor allem Frauen, Schwarze, sozial Engagierte, Leute aus der Unterschicht.
Konstantin reiht sich in den libertären Tenor seiner Vorrednerinnen ein, indem er auf die Initiativen verweist, die im Rahmen der Black-Lives-Matter-Proteste in den USA zur Definanzierung und Auflösung der Polzeibehörden entstanden. Das Geld sei besser in Sozialarbeitsprojekte und alternative Gerechtigkeitsmodelle investiert. Ihm ist wichtig zu betonen, dass für ein linksradikales Jena geboten ist, mit jeder Staatsmacht kritisch umzugehen, auch einer solchen, die von der Linkspartei regiert wird. Dass Parteien von der Versammlung von vornherein ausgeschlossen wurden, „damit müsst ihr leben,“ sagt er. „Ihr seid auch die Herrschenden.“
Die Linkspartei müsse letztlich „der Staatslogik folgen,“ betont Konstantin, das habe man beobachten können, als Bodo Ramelow nach dem „Dammbruch“ der Kemmerichwahl seine Stimme einem AfD-Abgeordneten bei der Wahl um die Landtagsvizepräsidentschaft gegeben hatte, ohne dabei auf breite Empörung zu stoßen. Auch dass Gefängnisse in der Coronakrise als Infektionsherde besonders gefährdet sind, hätte der grüne Justizminister Dirk Adams ohne Weiteres in Kauf genommen, obwohl sich die Gefangenensolidaritätsgruppe in Jena an die Regierung gewandt hatte.
Hinzu komme, dass Menschen aus dem rot-rot-grün regierten Thüringen abgeschoben werden, dass das Land sich in der Coronakrise nur für die Aufnahme von 500 Geflüchteten aus den griechischen Lagern bereiterklärt hat und der Verfassungsschutz, den die LINKE aufzulösen gedachte, allein „demokratisch angemalt“ worden sei. Die Zuhörenden und Beifall Klatschenden wissen wohl schon längst: Mit einem linksregierten Thüringen ist man der „freien Stadtgesellschaft“, die sich die Redner*innen aus direkter Betroffenheit und Solidarität mit anderen wünschen, nicht grundlegend nähergekommen. Erneut plädiert Konstantin dafür, eigene Organisationen zu gründen, um gegen diesen Zustand anzugehen.
Paula, die für Jugend gegen Rechts spricht, hat so etwas im Blick. Sie nähert sich dem plastikumhüllten Mikrofon mit den Worten: „Die Polizei ist kein Freund und Helfer – auf jeden Fall nicht für alle Menschen.“ Ausgenommen von polizeilicher Hilfe seien beispielsweise häufig BPoC, Obdachlose und Jugendliche. Sie spreche hier für die Anliegen Jugendlicher. „Sich ohne die Anwesenheit von Autoritäten aufzuhalten, auszuleben und auszutauschen“ sei ein Bedürfnis vieler Jugendlicher, das in der Lokalpolitik bisher nicht ausreichend wahrgenommen werde. Zu oft seien Jugendgruppen Repressionen ausgesetzt.
Als Beispiel nennt Paula die erhöhte Polizeipräsenz bei der Kegelbahn im Paradies seit einer Auseinandersetzung vor zwei Wochen. Die Polizeipräsenz führe dazu, dass Jugendliche – besonders als migrantisch gelesene – an andere Orte verdrängt würden, weil sie sich an staatlich überwachten Orten einfach nicht mehr wohlfühlten. Jugendschutz sei hier nur ein Vorwand, das Vorgehen gilt Paula auch als „pädagogisch destruktiv“. Der Dialog mit der Stadt werde allein über ein paar wenige Sozialarbeiter*innen geführt. Ein selbstverwaltetes Jugendzentrum hält sie daher für „längst überfällig“. Der Kriminalisierung Jugendlicher solle der Stadtrat zudem mit weniger Polizeikontrollen, und stattdessen Stellenausbau bei der Straßensozialarbeit entgegenwirken – eine klare Forderung, die ausnahmsweise direkt an ein staatliches Organ gerichtet ist.
Der Abend klingt langsam aus, es ist immer noch hell. Was bleibt? Der ferne Hall von Punkmusik, bis in die Innenstadt hinein. Etwa auch eine Perspektive auf „Gegenmacht“, wie sie Konstantin angemahnt hatte? Gegen Staat, Kapital, Patriarchat? Das wird sich daran entscheiden, ob das Motto „linksradikales Jena“ letztlich doch als Selbstvergewisserung der ohnehin anarchistisch Gesinnten zu verstehen ist oder als ein erstes Aufbäumen nach dem Corona-Schock, wie man es zuletzt mit ungeheurer Wucht in den USA beobachten konnte.
Dass sich die Jenaer Linke vom bürgerlichen Staat nicht abspeisen lässt, darauf kann man sich verlassen. Dass sie von den realen Problemen der meisten Menschen entfremdet sei – ein fehlplatziertes Klischee. Hier sprechen alltägliche Menschen über alltägliche Probleme – und die heißen in diesem sogenannten Normalzustand zum Beispiel: Geldmangel, sexuelle Gewalt, Kriminalisierung, der verzweifelte Blick auf Europas Außengrenzen. Hier sprechen Menschen – und das macht sie für den Staat gefährlich – auch über die größeren Zusammenhänge dieser Probleme: Klassenherrschaft, Patriarchat, Rassismus. Und doch ist es noch zu früh, um sagen zu können: Hier spricht Jena. Die Polizei, die sich hier wohl vorsichtshalber zivil untergemischt hat, genießt auch in dieser Stadt einen Respekt, der jene größeren Zusammenhänge vollkommen verkennt. Aber immerhin: Die „Minimalforderungen“ sind mit dem Protestfest abgesteckt.
(pj)
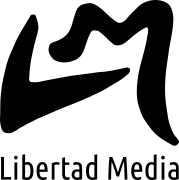
Beim Lesen des gut geschriebenen Berichts über das „Protestfest“ linker Gruppen gewann ich den Eindruck, daß es dabei (erfreulicher Weise) sehr friedlich zuging. Hoffnung gibt mir der abschließende Satz: „Daß sich die Jenaer Linke vom bürgerlichen Staat nicht abspeisen läßt, darauf kann man sich verlassen.“ Ich hoffe darauf!