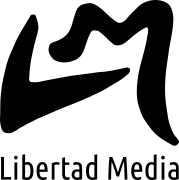Wenige stehen so ikonisch für kompromisslosen Klassenkampf wie der Revolutionär Karl Liebknecht (1871-1919), hier bei einer Rede im Berliner Tiergarten 1918. Im Jahr seines 150. Geburtstages wird es Zeit, ihn wiederzuentdecken. Bild: Bundesarchiv
Es gehört gewissermaßen zur ideellen Denkmalspflege der Linken, sich mit den Irrungen und Wirrungen der SPD mittels ihrer historischen Opfer zu beschäftigen. Besonders der Doppelmord an Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht zu Beginn der Weimarer Republik gilt als symptomatisch für die Machtversessenheit einer verkommenen, ehemals revolutionären Partei. Rosa Luxemburg erfährt darüber hinaus häufig Beachtung als Theoretikerin, deren Gedanken zur politischen Ökonomie, zur „Spontaneität der Massen“ und zur russischen Revolution bis heute rezipiert werden. Auch als Briefeschreiberin dürfte sie einigen bekannt sein. Aber was ist mit ihrem berühmten Mitstreiter? Was hat uns Karl Liebknecht noch zu sagen? Der Autor und Regisseur Klaus Gietinger meint: eine ganze Menge. Mit seiner Liebknecht-Monografie, die pünktlich zu dessen 150. Geburtstag im August im Berliner Karl-Dietz-Verlag erschienen ist, möchte er die kommunistische Ikone „aus der Versenkung holen“.
In dem Buch, das in der Reihe „biografische Miniaturen“ des Marx-Engels-Hausverlags publiziert wurde, widmet sich Gietinger in einem biografischen Essay Liebknechts Vita und lässt ihn im zweiten Teil selbst zu Wort kommen. Der Herausgeber hat sich bereits in mehreren Büchern mit der Novemberrevolution von 1918/19 befasst und kann als Experte auf dem Gebiet dieses „verpassten Frühlings des 20. Jahrhunderts“ gelten, wie er das Scheitern der sozialistischen Umwälzung andernorts bezeichnete. Dabei hätte Liebknecht im November 1918 vielleicht das Zünglein an der Waage sein können, um die Revolution gegen die rechte Mehrheits-SPD um den späteren Reichspräsidenten Friedrich Ebert zu entscheiden – wäre man seinem Rat gefolgt, die Mobilisierung der Massen früher zu beginnen als es letztlich geschah.
Väterlicherseits vaterlandsloser Geselle
Dieser Kampfgeist ist Karl als Abkömmling des SPD-Gründers Wilhelm Liebknecht und mit zwei Taufpaten namens Karl Marx und Friedrich Engels in die Wiege gelegt worden. 1871 in Leipzig geboren, ist er ein Kind des Kaiserreiches und seiner Bismarckschen Sozialistengesetze, die die Mitglieder der SPD kriminalisierten. Sein eigenes Engagement erreicht jedoch erst zu Beginn des 20. Jahrhunderts seinen Höhepunkt, als ihn zwar nicht länger die Illegalisierung der Partei trifft, die europäischen Staaten aber eine imperialistische Ausdehnung verfolgen, die 1914 in den Ersten Weltkrieg mündet. Für Liebknecht ist das diffamierende Prädikat des „vaterlandslosen Gesellen“, das das preußische Bürgertum gegen Sozialdemokrat*innen lanciert, ein „Ehrentitel“, wie er selbst sagt.
Als Rechtsanwalt verteidigt er in den 1900er Jahren mehrere Genoss*innen, darunter Redakteure des Vorwärts, und verhindert die Ausweisung russischer Emigranten. 1906 lernt er seine Geliebte und spätere zweite Ehefrau Sophia Borissowna Ryss kennen (Adressatin von Luxemburgs berühmten Briefen aus dem Gefängnis) und veröffentlicht einen Artikel mit dem Titel „Rekrutenabschied“, dem im Jahr darauf das Traktat Militarismus und Antimilitarismus folgt. Aufgrund seiner scharfen Kritik am preußischen Obrigkeitsstaat in Solidarität mit der proletarischen Jugend wird er wegen Hochverrats zu anderthalb Jahren Festungshaft verurteilt. In Gietingers Miniatur sind Auszüge aus den beiden Schriften abgedruckt, in denen das Verhältnis zwischen Militarismus und Klassengesellschaft ausbuchstabiert wird. In Militarismus und Antimilitarismus tut sich Liebknecht auch als Kritiker des europäischen Kolonialismus hervor. Dort heißt es:
Während [die Kolonialarmee] für England außer der Aufgabe einer Unterdrückung oder Inschachhaltung des kolonialen „inneren Feindes“, nämlich der Eingeborenen der Kolonien, die Aufgabe eines Machtmittels gegen den äußeren Kolonialfeind, zum Beispiel Rußland, erfüllt, fällt ihr, oft unter der Firma „Schutztruppe“ oder „Fremdenlegion“, bei den übrigen Kolonialstaaten, besonders Amerika und Deutschland, fast ausschließlich die erste Aufgabe zu, die Aufgabe, die unglückseligen Eingeborenen zur Fron für den Kapitalismus in die Bagnos zu treiben und, wenn sie ihr Vaterland gegen die fremden Eroberer und Blutsauger schützen wollen, erbarmungslos zusammenzuschießen, niederzusäbeln und auszuhungern. Die Kolonialarmee, die sich vielfach aus dem Abhub der europäischen Bevölkerung zusammensetzt, ist das bestialischste, abscheulichste aller Werkzeuge unserer kapitalistischen Staaten. Es gibt kaum ein Verbrechen, das der Kolonialmilitarismus und der in ihm geradezu gezüchtete Tropenkoller nicht gezeitigt hätten.
Aus dem Ton dieser Passage geht bereits hervor, weshalb Liebknecht im Lauf seiner politischen Karriere im preußischen Abgeordnetenhaus und im Reichstag Ordnungsrufe sammelte „wie manch anderer Briefmarken“ (Gietinger): Er ist analytisch und rhetorisch kompromisslos.
Gegen den Rechtsruck
Hatte sich Liebknecht zu Beginn des Krieges noch dem Fraktionszwang gebeugt und der Bewilligung der Kriegskredite unter Einspruch stattgegeben, gewinnt seine Opposition gegen den SPD-Kuschelkurs mit der Reichsregierung über die Kriegsjahre immer mehr an praktischer Konsequenz. Nachdem er sich in Belgien über die Massaker der deutschen Armee informiert hat, lehnt er am 2. Dezember 1914 die Kriegskredite als Einziger im Reichstag mit seiner Stimme ab und bleibt dieser Haltung auch nach dem Ausschluss aus der SPD-Fraktion 1916 treu. In Reden, Artikeln und Flugblättern wettert er gegen das Hinschlachten der proletarischen Jugend im Namen eines fingierten Völkerzwists. Die Skepsis in der Fraktion wächst allmählich auf 30 Abweichler an. Die von der SPD enttäuschten Kriegsgegner*innen kapseln sich später in der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei (USPD) ab, wo auch jene radikalen Elemente Platz finden, die nicht zusehen wollen, wie der Klassenkampf zugunsten einer vermeintlichen Volksgemeinschaft endgültig geopfert wird. Der Name „Spartakus“, Verweis auf einen legendären aufständischen Sklaven im Römischen Reich, wird das Insignium der Kommunist*innen um Liebknecht und Luxemburg, ihr Widerstand im Bewusstsein, dass der Feind im eigenen Land stehe, der erste Schritt hin zu einer kommunistischen Partei.
Von August Bebel, einem Gründungsvater der SPD, ist Liebknecht immer dafür kritisiert worden, dem Militarismus eine zu zentrale Stellung in seiner Kapitalismuskritik eingeräumt zu haben. Nun, im Krieg, zahlt der Kommunist die Zeche für die von Bebel mitverantwortete Anbiederung der Partei an Staat und Kapital: Er wird zum Kriegsdienst eingezogen und muss Schützengräben ausheben. Er bleibt bei dieser Arbeit fest entschlossen, sich nicht am Blutvergießen zu beteiligen, sollte ein solcher Befehl an ihn gerichtet werden. Für Reichstagssitzungen ist er beurlaubt. Ein Jahr später sitzt er aufgrund fortgesetzter Anti-Kriegs-Agitation wieder in Haft. Gegen den Prozess wegen Landesverrats hatte es Streiks gegeben, die die Verurteilung aber nicht abwenden konnten. Erst Ende Oktober 1918 wird Liebknecht wieder aus dem Zuchthaus entlassen. Am 9. November ruft er die sozialistische Republik aus. Philipp Scheidemann von der Mehrheits-SPD ist ihm da bereits zuvorgekommen. Die Konsolidierung der von Scheidemann und Ebert angestrebten bürgerlichen Demokratie, die später als Weimarer Republik in die Geschichte eingehen wird, verlangt nach der Niederschlagung der Rätebewegung mithilfe des Militärs und wird die folgenden Jahre noch viele weitere Leben kosten.
Das Zerwürfnis mit einer verbürgerlichten Sozialdemokratie tat der Solidarität, die Liebknecht seitens der Arbeiterschaft genoss, zwar keinen Abbruch; es sollte nach der KPD-Gründung und dem Januaraufstand der Rätebewegung 1919 aber eine letzte tragische Wendung erfahren – in Form seiner Ermordung. Den von der Garde-Kavallerie-Schützen-Division der preußischen Armee ausgeführten Mord an Liebknecht und Luxemburg am 15. Januar hatte SPD-Reichswehrminister Gustav Noske höchstselbst abgesegnet. Der erste große Verrat der Sozialdemokratie, der mit der Billigung der Kriegskredite 1914 begonnen hatte, war damit vollendet, und der zweite, an der Revolution, setzte sich darin fort.
Ein Außenseiter zum Vorbild?
Klaus Gietingers biografischer Abriss zu diesem bewegten Leben ist durchweg parteiisch, aber nicht unkritisch. So zollt er besonders Liebknechts Engagement gegen das Rüstungskapital Respekt, welches zeitweise auch dessen Tätigkeit als Rechtsanwalt bedrohte. Gietinger möchte den DDR-Kult um den Politiker deshalb allerdings nicht wiedererwecken. Liebknecht aus der Versenkung zu holen bedeutet für ihn, den Kommunisten zumindest eines Teils seines Märtyrerglanzes zu befreien, also etwa das Scheitern der Rätebewegung, die das Deutsche Reich gen Sozialismus hätte führen können, anhand seiner Person grob nachzuzeichnen. Auch habe die DDR-Geschichtsschreibung über 1918 die Schlüsselrolle der revolutionären Obleute, also illegaler Betriebsräte, die wie Liebknecht gegen die mörderische Burgfriedenspolitik der SPD opponierten, systematisch unterbewertet. Grund, von dieser herausragenden Persönlichkeit abzusehen, ist das freilich nicht.
Man kann die Geschichte Karl Liebknechts als Tragödie oder wie Klaus Gietinger als bittersüße Heldengeschichte erzählen, als Biografie eines unbeugsamen Geistes, der von heutigen Sozialist*innen allzu häufig unterschätzt, ja beinahe vergessen wird. Beide Versionen haben sicher ihre Berechtigung, aber sie beantworten nicht die zentrale Frage, die sich allen potenziellen Gratulant*innen an diesem runden Geburtstag aufdrängt: Was bleibt? Eine Lehre, ein Idol?
Mit diesem Buch, das Liebknechts Programm Nieder mit dem Krieg, nieder mit der Regierung! im Untertitel trägt, ist in jedem Fall ein brauchbarer Zugang zu einem bedeutenden Leben für Freiheit und Sozialismus geschaffen. Vielleicht kann es die eine oder andere Vertreterin einer kommenden Generation von Kompromisslosen für den Kommunisten und seine Mitstreiter*innen begeistern. Mindestens genauso wichtig dürfte jedoch der prüfende Blick auf die Zeit des späten Kaiserreiches sein, den Liebknecht mittels seiner Schriften an die Leser*innen weiterträgt. Eine deutsche Schulbildung kann mit einer solchen Perspektive nur selten dienen; sie soll schließlich gute Staatsbürger*innen heranzüchten.
Anti-Imperialismus damals und heute
Und gibt es konkrete Anregungen, die uns diese Figur geben kann, oder müssen wir uns mit dem Beispiel ihrer revolutionären Tugenden zufriedengeben? Nun, mit der Agitation der proletarischen Jugend durch Anti-Kriegs-Propaganda, die Liebknecht der SPD anempfahl, ist wahrlich kein Auftrag für eine zeitgemäße sozialistische Politik im 21. Jahrhundert ausgesprochen, denn die historischen Bedingungen sind grundlegend andere. Gleichwohl behält das Motto „Wer die Jugend hat, hat die Zukunft“ seine uneingeschränkte Gültigkeit.
Auch Liebknechts Kritik am Militarismus lässt sich nicht so einfach auf heute übertragen, selbst wenn der Imperialismus nach dem Niedergang der Kolonialreiche nie aufgehört hat, im kapitalistischen Wettbewerb eine Rolle zu spielen. Liebknecht bleibt aber in diesem Punkt ebenso wenig in den Begebenheiten seiner Zeit gefangen. Genau wie der Militarismus für sich kein Merkmal allein des Kapitalismus ist, sondern jeder Klassengesellschaft, überspannt die Propaganda der Kriegstreibenden Epochen. Was im Spätkapitalismus eines kränkelnden American Empire der „Krieg gegen den Terror“ ist, war im Kaiserreich der deutsche Kampf „gegen den Zarismus“ – eine defensive Auseinandersetzung, die so in Wahrheit nie geführt wurde. Liebknecht begründete seine erste Ablehnung der Kriegskredite mit einer Ideologiekritik, die ein Jahrhundert später noch aufhorchen lässt:
Die deutsche Parole ‚Gegen den Zarismus‘ diente – ähnlich der jetzigen englischen und französischen Parole ‚Gegen den Militarismus‘ – dem Zweck, die edelsten Instinkte, die revolutionären Überlieferungen und Hoffnungen des Volkes für den Völkerhass zu mobilisieren. Deutschland, der Mitschuldige des Zarismus, das Muster politischer Rückständigkeit bis zum heutigen Tage, hat keinen Beruf zum Völkerbefreier. Die Befreiung des russischen wie des deutschen Volkes muss deren eigenes Werk sein.
Die Kriegstreiber, die Unzivilisierten bzw. Unkultivierten – das sind immer die anderen. Liebknecht verstand es wie kein Zweiter, die Hetze der Herrschenden zu enttarnen, so sorgfältig man sie auch in die Camouflage der Fürsorge einwickeln mochte. Heute muss das wohl besonders im Umgang mit dem Begriff der Frauenrechte gelingen, ehe das nächste humanistisch-militärische „Engagement“ unter amerikanischer Federführung winkt. Solidarität mit den sozialen Bewegungen anderer Länder schließt eine solche Distanz nicht aus.
Mord an einer Idee
Nicht nur politische Rhetorik sollte uns aber interessieren, wenn wir von Karl Liebknechts Vermächtnis sprechen, meint der Herausgeber. Für Theorie-Nerds stellt Gietinger ein paar Kostproben aus Liebknechts Fragment Bewegungsgesetze der gesellschaftlichen Entwicklung bereit, mithilfe derer man ihn als Kritiker der Marxschen Werttheorie kennenlernen kann. Ein Anhang mit weiteren Dokumenten, einer Zeitleiste, Kurzbiografien wichtiger Zeitgenoss*innen und Literaturempfehlungen vervollständigt den Überblick. Wer so verdorben ist wie dieser Rezensent, dass er beim Thema Kaiserreich nur an Bismarck und Bohème denkt, wird hier eines Besseren belehrt. Sich mit diesem Kapitel der Arbeiterbewegung zu beschäftigen lohnt sich, weil allein der Kontrast zur Klassengesellschaft von heute den Siegeszug der Reaktion im 20. Jahrhundert in seiner umfassenden Qualität erfahrbar macht. Es handelt sich um einen Siegeszug des Bürgertums, der sich mit den politischen Morden von 1918/19 erst ankündigte, in den krisengeplagten Weimarer Jahren weiter wütete und sich im Faschismus in einer Weise neu formieren konnte, die die organisierte Arbeiterbewegung beinahe ausrottete. Nur auf diesem Boden konnte der Antikommunismus der Adenauerzeit im Westen erst gedeihen, der spätestens mit der Wende auch in Ostdeutschland Einzug hielt und noch heute den politischen common sense mitbestimmt.
In diesem Buch öffnet sich der Leserin ein Türspalt zu einer Epoche, die fortschrittlich gesinnten Menschen allen Niederlagen der Kommunist*innen zum Trotz als eine verheißungsvolle im Gedächtnis bleiben sollte. Der Verstoßene Karl Liebknecht verkörperte das Versprechen der Befreiung des Proletariats selbst dann noch, als die Sozialdemokratie längst davon abgerückt war – und diesen Kurs in der Weimarer Republik sodann blutig zu verteidigen lernte.
Klaus Gietinger (Hrsg.): Karl Liebknecht oder: Nieder mit dem Krieg, nieder mit der Regierung! Dietz Berlin 2021, 189 Seiten. 12 Euro. ISBN 978-3-320-02387-4.