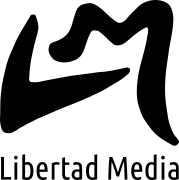Leon Pfannenmüller spielt den Mitläufer Sladek, der dem Pazifisten Franz Schminke (Pina Bergemann) den Ernst des Lebens erklärt. Bild: Joachim Dette/Theaterhaus Jena
Sladek ist der Name eines tragischen Helden in einem Stück von Ödön von Horváth. Sladek hält sich für das deutsche Vaterland, oder vielleicht doch nur einen Teil davon. Er ist noch jung, seine Jugend geprägt von Krieg und Inflation. Sladek ist ein Verführter, der gerne „selbstständig denkt“ und nur mit Menschen verkehren möchte, die auch selbstständig denken können. Umso verzweifelter klammert er sich an die handlichen Dogmen, die er sich auf diese Weise zusammengezimmert hat. „In der Natur wird gemordet, das ändert sich nicht.“ Ein Mantra, das zum Mitmischen einlädt. Will heißen: zum Morden.
Man könnte gleich fragen: Braucht es wirklich noch eine Theaterinszenierung, die sich mithilfe von Rückblenden in die Weimarer Republik mit dem sogenannten Rechtspopulismus unserer Zeit beschäftigt? Jedenfalls muss man etwas zu sagen haben, wenn man eine wagt. Lizzy Timmers scheut das Plakative nicht, wenn es um den historischen Vergleich geht. Für ihre Inszenierung am Theaterhaus Jena, die am 4. November Premiere hatte, wurde das Stück von der Schriftstellerin Manja Präkels bearbeitet. Der neue „SLADEK“ ist schrill, oft auch albern, und bleibt dabei hochpolitisch. Im Umgang mit Horváths Sujet der „schwarzen Armee“, einer Untergrundorganisation, die sich in der Weimarer Republik im Bruch mit dem Versailler Vertrag gründete, wollen die Dramatikerinnen nicht darauf herumreiten, dass sich Prepper- und WhatsApp-Nazis im deutschen Sicherheitsapparat heute einen ähnlichen Staatsstreich herbeisehnen wie der Hauptmann der Schattenarmee im Stück. Die beiden bevorzugen stattdessen das Psychogramm des verunsicherten Mitläufers Sladek, das ihnen der ungarische Dichter hinterlassen hat.
„Zu guter Letzt sind die Juden selbst schuld“
Sladek (Leon Pfannenmüller) ist ein Everyman, der sich durch eine Liebschaft mit einer reichen alten Jüdin namens Anna Schramm (Dorothea Arnold) ein Auskommen geschaffen hat. Die Affäre zeigt Erblassungserscheinungen, Sladek ist ihrer ein bisschen überdrüssig geworden und sehnt sich nach Neuem. Als Frau Schramm in der Ahnung, ihn an den militärischen Todeskult der „schwarzen Armee“ zu verlieren, droht, deren Machenschaften auffliegen zu lassen, wird sie von den Mitgliedern der Untergrundtruppe in ihrem eigenen Haus gelyncht. Unter Protest Sladeks, der den Mördern erst Zutritt zum Haus verschafft hatte, sie dann aber am Mord hindern wollte, als sich die alte Frau mit ihm plötzlich versöhnlich gezeigt hatte. Frau Schramm sei doch unschuldig gewesen, hält Sladek dem Hauptmann (Jonas Steglich) und seinen Gehilfen (Henrike Commichau, Hannecke van der Paardt) anschließend vor. Aber sie sei doch jüdisch gewesen, heißt es darauf, und „zu guter Letzt sind die Juden selbst schuld“.
Der Hauptmann der Truppe tritt als blutrünstiger Demagoge auf, der der Republik und dem Versailler Vertrag ein Ende machen will, während Sladek beständig schwankt, dem Nationalismus aber von Anfang an erliegt. Dass die Nationalen auch mit ihren kriegerischen Absichten richtig lägen, beweise ja allein die Tatsache, dass in der Natur immer schon gemordet werde. Sladeks Selbstvergewisserungen klingen ein bisschen lächerlich: „Ich hab‘ die Gerechtigkeit lieb, auch wenn es sie nicht gibt,“ sagt er. Es darf sie in einer Welt, in der das Recht des Stärkeren regiert, nicht geben.
Der Journalist Franz Schminke (Pina Bergemann) durchschaut das Spiel. Wegen seiner investigativen Recherchen zur schwarzen Armee wurde er von ihren Mitgliedern gefangengenommen. Franz ist ein Pazifist, der sich mit den kommunistischen Kriegsgegner*innen aber nicht gemein macht. Er pflegt als politischer Eigenbrötler eine „Ehrfurcht vor der einzelnen Kreatur“. Damit passt er nicht ins Bild der Verblendeten. In Gefangenschaft der schwarzen Armee legt er Rechenschaft über seine Überzeugungen ab – und auch über seine Ernüchterung. Sein Weltschmerz ist das freundliche Spiegelbild von Sladeks fratzenhafter Zwiegespaltenheit:
Ich glaube nicht an den Frieden, aber ich predige ihn.
Schminke, der von Pina Bergemann gekonnt mit ironischer Selbstdistanz dargestellt wird, möchte die Hoffnung der Wenigen, die sich den Friedensglauben bewahren konnten, nicht zerstören. Auch hier ist eine Ehrfurcht vor dem individuellen Seelenheil am Werk.
„Der Einzelne ist eine Null“
Für den Hauptvertreter des nationalistischen Kults ist die Sache mit dem Individuum klar: „Der Einzelne ist eine Null,“ sagt der Hauptmann. Als Opfer protofaschistischer Selbstjustiz fällt der Einzelne also nicht ins Gewicht, als Vertreter der nationalen Wende kann er auf sich allein gestellt nichts bewirken. Das Ringen um die Bedeutung des Individuums, das sich durch das ganze Stück zieht, ist der Frage um die Gewaltträchtigkeit des Lebens durchaus verwandt. Schon der Begriff des Faschismus spielt auf ein Rutenbündel an, das in seiner Einheit nicht zerbrochen werden kann. Eine Einheit, die die totale Unterwerfung nicht von jedem Einzelnen zwingend erfordert, wie die Sladeks der Geschichte bewiesen haben. Gerade der Schein der Selbstermächtigung und des „Selberdenkens“ im nationalen Kollektiv macht das Mitläufertum für den Einzelnen so betörend – und im Rückblick so entlastend. Sladeks Bedürfnis, sich zu individuieren, wird immer mehr in den Dienst eines Selbstbetrugs gestellt, der ihm die Autonomie des eigenen Gewissens bescheinigt.
Die Sehnsüchte des Protagonisten sind deshalb auch mit einer Prise Eskapismus versehen. Exotisierend spricht er im Monolog vom fernen Nicaragua, wo er sich erhofft, zur Abwechslung einmal in Ruhe über das Vaterland sinnieren zu können statt im politischen Handgemenge der umkämpften Republik. Der Querdenker der ersten Stunde befindet sich ideologisch nur vermeintlich in der Schwebe. In Wahrheit ist er ein Produkt seiner Zeit, eines enttäuschten, aber unüberwundenen Kriegstaumels.

Der Hauptmann schwimmt auf der Meute. Zur Kammerspielkulisse von SLADEK gehört eine Holzkiste mit der Aufschrift „SWASTIKA“ (Hakenkreuz), von der ein ominöses Grummeln ausgeht. Bild: Joachim Dette/Theaterhaus Jena
Geglückte Verfremdung
Einfühlen kann man sich in den Reiz der politischen Alternative, den Gruppenzwang der Kameraden und den Kontrollverlust Sladeks in Timmers‘ Inszenierung nicht. Diese psychologischen Feinheiten liegen allesamt unter Verfremdungseffekten und szenischen Ablenkungsmanövern vergraben. Was aber auch einen Unterhaltungswert für sich hat. So tritt Dorothea Arnold aus ihrer Rolle der Frau Schramm heraus und antizipiert ihre Sterbeszene, die ja doch nur dazu da sei, um die Handlung voranzubringen. Hannecke van der Paardt, die soeben noch den baldigen Mörder Schramms verkörperte, pflichtet ihr bei: „Strippen oder Sterben“ laute die Losung des Theaters besonders für Jungschauspielerinnen, seit ihnen der Theaterbetrieb offensteht. Manja Präkels kokettiert aber nicht nur mit den Konventionen des Stücks, sondern gibt Frau Schramm auch nach ihrem Tod noch Gelegenheit, sich zu Wort zu melden.
Horváths Figur der Anna Schramm steht in „SLADEK“ exemplarisch für Hunderte von rechten Fememorden nach 1918, die sich gegen vermeintliche Verräter*innen an der nationalen Sache richteten und von Strafgerichten wenn überhaupt, dann äußerst milde bestraft wurden. Auch hier sind unserer Gegenwart die „Weimarer Verhältnisse“ unschwer anzusehen. Der deutsche Staat zeigt sich gleichmütig und schlampig wie eh und je gegenüber rechten Umsturzvorbereitungen und Attentaten. Der Karrierepolitiker von Rang begnügt sich, wenn er darauf angesprochen wird, mit dem Verweis auf die bolschewistische Gefahr, die heute „Linksextremismus“ heißt. Heute wie zur Zeit des Mordes an Walther Rathenau lassen sich linke Feindbilder selbst da herbeifantasieren, wo sie von einer nüchternen Betrachterin kaum auszumachen sind. Die AfD hetzt gegen die Grünen, deren Herz schon lange nicht mehr links schlägt, und stellt sich im Einklang mit der ungarischen Fidesz-Partei quer gegen die EU-Bürokrat*innen, die lediglich auf eine andere Form der bürgerlichen Ordnung pochen, als sie ein Höcke oder Orbán anstreben.
„SLADEK“ reiht sich mit seiner Zeitdiagnose in eine nun schon Jahre andauernde Auseinandersetzung des Theaters mit der alten Neuen Rechten ein. Ausgelutscht ist der Stoff nicht, gerade weil Manja Präkels und Lizzy Timmers mit der Figur des wankelmütigen Sladek einen wutlosen Wutbürger in Szene gesetzt haben. Wo die Verblendung einen Freidenker-Habitus pflegt, wird ihre Macht für die Zuschauenden erst richtig sichtbar. „SLADEK“ zeigt die Variationen faschistischer Mittäterschaft in bunter Montur und beweist, dass die jubelnden Massen auf NS-Propagandafilmen kein Richtwert sind, um die Gefahren unserer Zeit zu bemessen. Am Anfang steht die Sinnsuche einer „Jugend, die nicht sein will“ – oder kurz: Sladek.
Die Premiere von „SLADEK“ fand am 4. November als Teil des überregionalen Theaterprojekts „Kein Schlussstrich!“ im Theaterhaus Jena statt. Verbleibende Aufführungen am 5.11., 25.11., 26.11. und 27.11., jeweils ab 20 Uhr. Tickets und weitere Informationen gibt es auf der Webseite des Theaterhauses.