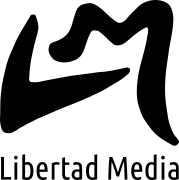Gedenkkundgebung zum ersten Jahrestag des antisemitischen und rassistischen Terroranschlags von Halle. Bild: Martin Michel – Libertad Media
Jena. Am Holzmarkt fand am Freitagabend eine Kundgebung der Sozialistischen Jugend Deutschlands (Falken) statt, die an den antisemitischen, rassistischen und antifeministischen Anschlag auf eine Synagoge und einen Dönerimbiss in Halle erinnerte, der vor einem Jahr an Jom Kippur verübt wurde. Dem geständigen Täter war es nicht gelungen, gewaltsam in die Synagoge einzudringen. Er erschoss daraufhin die Passantin Jana Lange, die ihn konfrontierte, und den Gast eines nahe gelegenen Dönerimbisses, Kevin Schwarze.
In ihrem Eingangsbeitrag stellten die Falken insbesondere das fehlende Bewusstsein für weit verbreitete rechte Gesinnungen heraus, auch mit Blick auf den rassistischen Anschlag auf eine Shishabar in Hanau im Februar dieses Jahres. „Wie lange noch wird das Wort ‚Einzelfall‘ im Plural gebraucht, bis sich die Einsicht durchsetzt, dass menschenverachtende Ideologien ein strukturelles Problem der Polizei, aber auch der ganzen Gesellschaft sind?“ erhallte es im Regen durch das Jenaer Stadtzentrum.
Die „lückenlose Aufklärung“ des Angriffs in Halle – eine Forderung, die auch oft auf der letzten Kundgebung in Hanau zu hören war – erfordere jenseits des im Juli angelaufenen Gerichtsprozesses in Magdeburg eine „gesamtgesellschaftliche Auseinandersetzung“ mit Antisemitismus, Rassismus und Antifeminismus. Weitere Forderungen waren die Abschaffung des in rechte Strukturen verstrickten Verfassungsschutzes und unabhängige Beschwerdestellen für polizeiliche Übergriffe und Fehlverhalten.
Eine Rednerin des Jungen Forums der Deutsch-Israelischen Gesellschaft sprach darüber, wie der Anschlag in Halle und die Vertuschung eines breit geteilten Antisemitismus für viele Jüd*innen einen Verbleib in Deutschland zur Disposition gestellt, gar verunmöglicht hat. Sie verwies dabei auf die „Tradition des mörderischen deutschen Antisemitismus“. Diese Geschichte ziehe sich über einen Brandanschlag auf eine jüdische Seniorenresidenz in München im Jahr 1970, die mehrere Shoah-Überlebende tötete, bis zum Attentat letzten Jahres auch durch die Geschichte Nachkriegsdeutschlands.
Judenhass offen zu thematisieren, störe offenkundig „die Inszenierung Deutschlands und der Deutschen als Wiedergutgewordene“. Auch werde die Verantwortung gerne auf die jüdische Community selbst geschoben, wie in der kontrovers diskutierten Aussage Reiner Haseloffs, des Ministerpräsidenten Sachsen-Anhalts, der Anschlag in Halle „wäre nicht passiert, wenn es mehr Versöhnung gegeben hätte.“ Genauso verfehlten Pathologisierungen der Täter*innen das strukturelle Problem. Es hieß weiter:
Statt Jüdinnen und Juden der Zumutung auszusetzen, ihr Leben zu riskieren, wenn sie sich als Jüdinnen und Juden zu erkennen geben, ist es notwendig, den Kampf gegen Antisemitismus nicht nur in immergleichen Phrasen zu reproduzieren, sondern ihn aktiv und gegen gesellschaftlliche Widerstände zu führen. Dazu gehört auch die Einsicht, dass Antizionismus, also der Israel-bezogene Antisemitismus, die heute virulente Form der Judenfeindschaft darstellt und an politischen Grenzen nicht Halt macht.
Das Bündnis „NSU-Komplex Auflösen“ stellte derweil Parallelen im Prozess in Magdeburg mit den Verhandlungen zum „Nationalsozialistischen Untergrund“ in München heraus. So werde von Gerichten oft verkannt, welchen Beitrag lokale und digitale Nazi-Strukturen zu rechten Übergriffen leisteten, weil von Einzeltäter*innen oder einem engen Kreis von Konspirateur*innen ausgegangen werde. Die Jenaer Ortsgruppe des antifaschistischen Bündnisses resümierte:
Das Unsichtbarmachen der Perspektive und der Leben von Betroffenen von rechtem Terror, gepaart mit der Ignoranz und dem Unverständnis gegenüber der Ideologie und den Netzwerken hinter den Täter*innen, sind symptomatisch für den Umgang mit rechtem Terror in Deutschland. Er ermöglicht Täter*innen, Gerichtsprozesse sogar noch als Bühne für ihre ideologische Weltsicht zu nutzen.
Den mutmaßlichen Täter gelte es daher „des Wortes zu beschneiden“. Wiederum wurde festgestellt, dass sowohl im Umgang mit dem Täter als auch in der Aufklärung der Ursachen und Hintergründe kein Verlass auf den deutschen Staat sei.
Die Kundgebung beinhaltete auch eine zum Prozessauftakt aufgezeichnete Audiobotschaft der Nebenklägerin und Betroffenen Christina Feist. Sie attestierte der deutschen Gesellschaft im Angesicht alltäglicher Beleidigungen und Übergriffe auf Jüd*innen, es habe sich in 100 Jahren nichts an deren Antisemitismus geändert. Die deutsche Gesellschaft und ihre Politiker*innen verweigerten sich der Realität und gäben sich meistens nur Lippenbekenntnissen hin. „Nie wieder“ seien nur leere Worte. Feist mahnte dazu, solche Angriffe wie den in Halle 2019 „endlich persönlich zu nehmen“. Aktives Einmischen und Zivilcourage seien geboten.
Zum bisherigen Verlauf des Halle-Prozesses meldete sich das Bündnis „Alles Muss Man Selber Machen“ zu Wort. Die Rednerin beklagte eine klassistische Voreingenommenheit aufseiten des Gerichts, „die die Tat verharmlost und den Täter entpolitisert“. Sich über die Arbeitslosigkeit des Täters und seinen Verbleib im Elternhaus lustig zu machen, wie es die Richterin am Landgericht Magdeburg getan habe, leiste keinen Beitrag zur Klärung der Tatumstände oder politischen Aufarbeitung und stigmatisiere andere Erwerbslose:
Das Problem ist nicht, dass der Täter arm ist und keinen Job hatte. Das Problem ist, dass er ein Neonazi ist – ein Mörder, ein Faschist.
Auch hätten sich Angehörige des Gerichts die rassistische Sprache des Täters unreflektiert zu eigen gemacht, wenn sie beispielsweise das N-Wort benutzten. Die Rednerin von „Alles Muss Man Selber Machen“ empörte sich über die mangelnde Kompetenz der Ermittelnden der Landes- und Bundeskriminalämter, über rechte Internet-Subkulturen auf Imageboards eigenhändig zu recherchieren und diese Räume der Bedrohungslage angemessen einzuschätzen. So habe ein Beamter die digitale Weiterverbreitung von Waffenbauplänen durch den mutmaßlichen Täter als irrelevant abgetan, ohne dabei dessen Anstachelung durch den Täter des neuseeländischen Christchurch-Massakers im März 2019 zu bedenken.
Von staatlichen „Sachverständigen“ wird hier nur in äußert ironischer Betonung gesprochen. Zu allem Übel sei die Polizei im Umfeld der Gerichtsverhandlungen auch noch durch einen taktlosen und uneinfühlsamen Umgang mit Angehörigen der jüdischen Gemeinde aufgefallen, was das „polizeiliche Versagen“ am Tag des Angriffs in gewisser Hinsicht fortsetze.
Es folgten wörtliche Zitate Überlebender aus der Synagoge und dem Dönerimbiss, abschließend ergänzt von einem Audiobeitrag von Boleslaws Kowalski aus der jüdischen Gemeinde Magdeburg.
Diese Stimmen dokumentierten Bekenntnisse zu einer emphatisch offenen Gesellschaft aufseiten jüdischer und migrantischer Gemeinden, aber auch das Bedürfnis nach mehr Sichtbarkeit im politischen Diskurs. Von dieser kämpferischen Menschenliebe und der Ehrfurcht vor den Mahnungen der Geschichte und Gegenwart können weiße, nicht-jüdische Teile der Gesellschaft viel lernen, nein: Das müssen sie.
(pj)