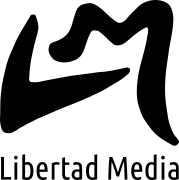Da lacht er noch: NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) im April bei einer Plakatkampagne für mehr Ehrenamt im Katastrophenschutz. Bild: 2021, Innenministerium NRW
Dass ein Regierungspolitiker wie Herbert Reul nun den Flutopfern vorwirft, die Bedrohung unterschätzt zu haben, ist eine Bagatellisierung politischen Versagens. Die Schuldabwehrgeste hat aber einen wahren Kern, meint unser Autor. Ein Kommentar.
Der CDU-Innenminister von NRW Herbert Reul hat es wie sein Parteikollege Armin Laschet dieser Tage schwer, Sympathien für sich zu gewinnen. Es gibt offene Fragen, weil die Frühwarnungen des europäischen Flutalarmsystems EFAS (European Flood Awareness System) ignoriert worden sein könnten, wie die Sunday Times in Berufung auf die britische Hydrologin Hannah Cloke berichtete. Wurden Warnungen nur zögerlich weitergegeben, um die Bevölkerung nicht zu verunsichern?
Der WDR hat sich an einer Rekonstruktion des unheilvollen Vorspiels versucht und stellt fest: Das EFAS habe Anfang der Woche, am Morgen des 12.7., bereits gewarnt. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) habe am Abend die Hochwasserzentralen der Länder gewarnt. In NRW wussten dann auch die Bezirksregierungen zwei Tage vor Einbruch der Katastrophe Bescheid, die öffentlichen Bekanntgaben, die der WDR zitiert, sprechen jedoch nicht von einer akuten Gefahrenlage. Eine erste „extreme Unwetterwarnung“ habe der DWD am Dienstagmorgen herausgegeben. Ein zentrales Problem im weiteren Verlauf ist laut WDR der unterschiedliche Umgang der Kommunen mit den zu Mitte der Woche verfügbaren Informationen. Am Donnerstag schlagen sich solche regionalen Unterschiede auch bei der Sirenenwarnung nieder; nun gelte festzustellen, ob diese an manchen Orten nicht einsatzfähig waren. Fest steht vorerst: Die vorhandenen Warnungen haben nicht zur Verhinderung des Schlimmsten beigetragen. In einer Pressekonferenz gab Reul am Montag bekannt, es könne nicht ausgeschlossen werden, dass noch weitere Leichen zu bergen seien.
Die Schuldeingeständnisse der NRW-Landesregierung fielen ähnlich wie bei den verantwortlichen Bundesministerien bislang mager aus. Reul versprach am Montag „schonungslose“ Aufklärung, wie man das von ihm kenne, wollte aber keine Anzeichen für Fehler sehen, die der Verwaltung nicht auch im Alltagsbetrieb unweigerlich unterlaufen wären. Er unterstellte der öffentlichen Kritik damit, zu hohe Erwartungen an die Arbeit der Behörden zu stellen, als ginge es hier nicht darum, dass sich die Regierung für fatale Versäumnisse zu verantworten haben könnte, sondern allein darum, es sei nicht alles reibungslos verlaufen. Keine Fehler machen? Sarkastisch gab Reul zu Protokoll, „Es gibt vielleicht Leute, die können das – stellen wir demnächst ein.“
Aber damit nicht genug. Daran anschließend legte er den anwesenden Pressevertreter*innen nahe, die Gefahren der Flut seien für die Betroffenen absehbar gewesen. Die Wettervorhersagen, die den Starkregen ankündigten, der mehrere Flüsse über die Ufer treten ließ, habe die Bürger*innen vorab aufgeklärt. Sollte diese Sichtweise Anklang finden, wäre der Landesregierung selbst dann nichts mehr vorzuwerfen, wenn sie sich der Versäumnisse schuldig gemacht hätten, die momentan im Raum stehen. It was on the forecast, stupid!
Die Empörung über diese Aussage in den sozialen Medien war groß. Von „victim-blaming“ war auf Twitter die Rede. Berücksichtigt man, dass die NRW-Landesregierung unter der CDU schon seit Jahren lieber Klimaaktivist*innen bekämpft als die Klimakrise, ist die Vermessenheit der Regierungsstatements der letzten Woche ja wirklich kaum auszuhalten. Reul erdreistete sich noch zu der Aussage:
Das Wesen von Katastrophen ist, dass sie nicht vorhersehbar sind. Das Wesen von Naturkatastrophen ist, dass sie erst recht nicht vorhersehbar sind. Das ist doch klar.
Ministerpräsident Armin Laschet hatte sogar bei seinem Besuch im Katastrophengebiet behauptet, sein Land, das mit dem rheinischen Braunkohlerevier die größte CO2-Quelle Europas beheimatet, sei ein Vorreiter in Sachen Klimaschutz und werde seine Anstrengungen nun noch verschärfen. Stehen diese blanken Lügen aber auf einer Ebene mit der Behauptung, es habe sich bei der Flutkatastrophe um eine kollektive Unterschätzung des Gefahrenpotentials gehalten? Nein.
„Urvertrauen in die Welt“ muss man sich leisten können
Je genauer man sich sogenannte Naturkatastrophen ansieht, desto mehr zieht man in Zweifel, dass „die Natur“ daran den entscheidenden Anteil hat. Sicher gehören sie zu den wenigen Katastrophen, die vorhergesagt werden können, eben weil sie Naturgesetzen unterliegen. Dennoch ist der Satz „There’s no such thing as a natural disaster“ in der Geografie schon zur Binsenweisheit geworden. Zum Einen treffen Umweltkatastrophen die „Verdammten dieser Erde“ meist am härtesten und – global gesehen – auch häufiger. Zum Anderen ist die öffentliche Wahrnehmung globaler Ungleichheiten schief, weshalb die Klimakrise auch erst so richtig bei Menschen in Deutschland „ankommt“, wenn wir eine Verwandte an Extremhitze oder eine Flutkatastrophe verlieren, und nicht etwa, wenn ein Urwald mal wieder in Flammen steht. Ein Notfallseelsorger sagte im Deutschlandfunk nach dem Desaster letzter Woche, sobald unsicher sei, dass die eigenen vier Wände morgen noch an derselben Stelle stehen, sei „das Urvertrauen in die Welt gestört“. Zur bitteren Wahrheit über die Klimakrise gehört auch: „Urvertrauen in die Welt“ muss man sich erst einmal leisten können.
Bei Reul hieß es später:
Unser Problem ist – aber unser aller Problem – dass wir, glaube ich, solche Gefahren nicht ernst genug nehmen, sondern glauben, das passiert woanders.
„Woanders“ ist das Schlüsselwort. Was fehlt: Es handelt sich bei diesem nebulösen Kollektiv der Unterschätzungsweltmeister in Wahrheit um ein imperialistisches „Wir“. Auch Menschen, die sich von diesen Worten verhöhnt fühlen, weil sie zu den Wenigen gehören, die die Regierung schon seit Jahren auf die verheerenden Folgen der Klimakrise aufmerksam machen, müssen sich eingestehen, dass die Verdrängung ökologischer Lebensrisiken kein Phänomen allein der Mächtigen ist. Das fossile Kapital und seine parlamentarischen Parteispendenempfänger*innen profitieren zwar am meisten von dieser Verdrängung, müssen sich dabei aber immer auf die ideologische Kooperation der Bevölkerung verlassen können.
So löblich die Anstrengungen von Klimaforscher*innen wie Stefan Rahmstorf sind, die Desinformationskampagnen fossiler Konzerne mit wissenschaftlicher Präzision zu kontern, ist zu befürchten, dass wir hier gegen noch ganz andere Dämonen ankämpfen. Der Erfolg solcher Aufklärung fußt auf der Annahme einer Gesellschaft, die ihr eigenes Interesse an der Erziehung zur Mündigkeit erkannt hat. Die meisten dieser Initiativen haben ihre Rechnung jedoch ohne den kolonisierten Verstand gemacht.
Denn die Auslagerung der ökologischen Kosten „unseres Wohlstands“ in andere Weltregionen geht mit der psychischen Verdrängung dieser Auslagerung und der Tode, die sie Tag für Tag zeitigt, Hand in Hand. Hitzetode in Deutschland konnten daran bisher wenig rütteln, bildmächtige Flutkatastrophen vielleicht schon. Zwar treffen diese Bilder mit der Politisierung der Klimakrise der letzten Jahre auf fruchtbaren Boden. Die Macht der kollektiven Verdrängung darf gleichzeitig nicht unterschätzt werden. Sie hat einen gehörigen Anteil daran, dass sich die Gesellschaften des Globalen Nordens nun in einer Situation wiederfinden, in der die Dringlichkeit radikaler Klimaschutzmaßnahmen den Konsens der Regierten zu überdehnen droht. Von politischem Gestaltungswillen im Staatsapparat ganz zu schweigen.
Verdrängung in der Externalisierungsgesellschaft
Der Soziologe Stephan Lessenich schrieb von den globalen Zusammenhängen zwischen Armut und Umweltzerstörung im Süden und relativem Wohlstand im Norden, wir hätten es hier mit einem „verallgemeinerten Nicht-Wissen-Wollen“ zu tun. In seinem Buch Neben uns die Sintflut beschrieb er die Wohlstandsgesellschaften des Globalen Nordens, die ihrerseits natürlich von Klassenverhältnissen geprägt sind, als „Externalisierungsgesellschaften“. Nicht nur die ökologischen Kosten der Wohlstandsproduktion würden demnach ausgelagert, sondern auch deren politische Folgeprobleme, was es etwa der deutschen Gesellschaft erlaubt, sich vor Katastrophen in Sicherheit zu wähnen. Meistens gibt die Erfahrung diesem Eindruck ja auch recht. Man kennt das Ausmaß dieser Überflutungen eher von andernorts. Wie Reul sagte: „Die gucken wir uns im Fernsehen an.“
Lessenich zeigt sich in seiner Studie von 2016 verhalten optimistisch, dass sich dieser koloniale Blick nicht mehr lange halten wird. Der Grund: „Externalisierung“ ist letztlich unvereinbar mit einem ökologisch-ökonomischen Weltsystem. Er schreibt:
Wir müssen nur noch eins und eins zusammenzählen: das Elend der anderen mit unserem eigenen Wohlergehen in Verbindung bringen. Um es vielleicht unangemessen sarkastisch zu sagen: Das wird uns in Zukunft wohl leichter fallen. Jedenfalls wird es uns schwerer gemacht werden, die Realitäten globaler Ungleichheit nicht beim Namen zu nennen – und einfach so weiterzumachen wie bisher. Denn das Pendel schlägt zurück, die Externalisierung kommt nach Haus.
Die Prognose, es könne sich bald etwas ändern, fällt also deshalb leicht, weil es mit der Entstehung von Fluchtmigration gen Norden und der hiesigen Häufung von Umweltkatastrophen immer schwieriger wird, den kolonialen Blick in gleichem Maße anzustrengen. Scheuklappen müssen bei jedem Desaster versagen, auf das man geradewegs zurast. Jetzt kommt es darauf an, ob sich Gesellschaften wie unsere für einen Augen-zu-und-durch-Kurs entscheiden. Klimabewegung und Wissenschaftler*innen machen seit Jahren deutlich: Ein „Durch“ gibt es eigentlich gar nicht, denn wir steuern auf eine Erderhitzung zu, die mit organisiertem menschlichen Leben unvereinbar ist.
2016 meinte Lessenich noch: „Mit Wegdenken kann man hierzulande immer noch Wahlen gewinnen.“ Und der Optimismus, dass sich dies mit der jüngsten Katastrophe ändern wird, sollte in der Tat ein verhaltener sein. Das zeigt nicht zuletzt die Hartnäckigkeit des Eurozentrismus. In Madagaskar wütet gerade eine schwere Hungersnot infolge jahrelanger Dürren. Ein emissionsarmer Inselstaat durchlebt eine Katastrophe, die keine internationale Aufmerksamkeit auf Höhe von Deutschlands Problemen erhält. Woanders eben. Selbst dann, wenn die Menschen „hier“ der Klimakrise endlich gewahr werden, fügt sich dieses neue Bewusstsein in koloniale Muster ein.