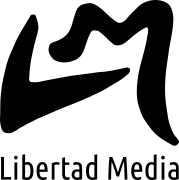Die freie Schauspielerin Elisa Ueberschär hofft, dass Corona einen Lerneffekt im Umgang mit der Kultur zeitigen wird. Bild: Joachim Gern
Elisa Ueberschär kann als freie Schauspielerin für Theater und Fernsehen ein Lied davon singen, welche doppelten Standards bei Kulturschaffenden angelegt werden, wenn es um Arbeitsverbote zur Bekämpfung der Corona-Pandemie geht. Sie war im Theaterhaus Jena letzten Oktober in der Inszenierung „Zur Wartburg“ zu sehen, das bald nach der Premiere aufgrund neuer Kontaktbeschränkungen wieder auf Eis gelegt wurde. Fürs Fernsehen spielt sie unter anderem bei der Kinder-Soap „Schloss Einstein“ mit. Ich treffe sie zu einem Videogespräch, um nach einem Jahr Kulturkrise Bilanz zu ziehen.
Rettungspakete – eine ungleiche Gewichtung
Die Atmosphäre ist entspannt, die Lage ernst. Zu Beginn unseres Gesprächs macht mich Elisa Ueberschär auf ihren Pullover aufmerksam, der die Aufschrift „#monike“ trägt – eine Anspielung auf das Performance-Kollektiv ihrer Schauspielkolleginnen Henrike Commichau und Mona Vojacek Koper, die mit ihr zusammen letztes Jahr an der Inszenierung von „Zur Wartburg“ beteiligt waren. Das Outfit passt also zur Online-Telefonschaltung nach Jena, denn ich erreiche Elisa in ihrer Wohnung in Leipzig.
Auf meine erste Frage, ob sie sich denn „systemrelevant“ fühle, wie es nach dem inoffiziellen Unwort des Jahres 2020 heißt, antwortet sie mit einem klaren Nein. Die Rettungspakete für große Unternehmen, etwa die 9 Milliarden Euro schweren Zuwendungen für die Luthansa zur Sicherung ihrer Arbeitsplätze und Wettbewerbsfähigkeit, haben ihr Vertrauen in die Regierung erschüttert. Das unternehmerische Risiko scheine keine Rolle zu spielen, sobald es um den Wirtschaftsstandort Deutschland gehe, meint Elisa Ueberschär. Die Staatshilfen ließen es den meisten Unternehmen auch offen, ob sie Dividenden an ihre Aktionär*innen auszahlen – eine Lücke, die zum Beispiel Deutschlands große Autobauer VW, BMW und Daimler ausnutzten. „Ich verstehe die Gewichtung überhaupt nicht,“ sagt sie, denn Arbeitsplätze hängen auch an der Kulturbranche, ungefähr 1,8 Millionen. Es ist eine Frage der Lobby, deren Schwäche sich bei Freiberufler*innen noch einmal schmerzlicher bemerkbar macht.
Ob fest oder frei, kann über das finanzielle Überleben entscheiden
Immerhin der Umgang des Jenaer Theaterhauses mit Gastschauspieler*innen habe gestimmt, sagt Elisa. Hier musste sie sich keine vertraglichen Bedingungen extra erkämpfen, die für Festangestellte selbstverständlich sind. Anders bei einem Theater in NRW: Dort habe man versucht, ihr eine „juristische Finte“ unterzujubeln, eine Erklärung, mit der sie faktisch von ihren vertraglichen Ansprüchen zurückgetreten wäre. Besonders große Theaterhäuser hätten sich durch solche Praktiken während der Coronakrise unter Schauspieler*innen einen Namen gemacht. Das findet Elisa Ueberschär unverzeihlich:
Man muss sich einfach mal überlegen, wofür ein Theater steht. Nach außen hin schön linksgerichtete Slogans bringen, humanitäre Werte vertreten, auf der Bühne große Theme verhandeln – es geht immer um Machtverhältnisse, um Underdogs (…) – und dann geht man innerbetrieblich so unfassbar scheiße mit den Menschen um.
Elisa hätte mehr Verständnis dafür gehabt, wenn solche Theaterhäuser ihre Ratlosigkeit im Umgang mit der Krise transparent gemacht hätten, etwa weil ihnen eine Rückzahlpflicht der öffentlichen Gelder droht, die sie dann für Gastschauspieler*innen eines abgesagten Stücks bereits ausgezahlt hätten. Stattdessen versuche man sich lieber aus der Affäre zu ziehen und gegen Lohnansprüche von Gästen abzusichern, berichtet sie aus ihrem Umfeld. Das hat ihr Vertrauen in das Theaterhaus Jena jedoch wiederum gestärkt, weil dort solidarisch mit Gästen umgegangen werde. Bei der Genossenschaft Deutscher Bühnen-Angehöriger (GDBA) konnte sie sich bei ihrem zweiten Engagement Rechtsbeistand holen und Bezahlung gemäß einer Kurzarbeitsregelung erhalten. Ohne diese beiden Engagements und die vom Bund bereitgestellten Ausfallhonorare hätte sie es wohl nicht durch das letzte Jahr geschafft. „Ich hatte wahnsinnig Glück, weil ich letztes Jahr durch meine Festanstellungen keinen finanziellen Ausfall hatte. Das war einfach meine Rettung.“ Ein Ausnahmefall unter Freiberufler*innen, die über das Arbeitnehmerschutzgesetz nichts erwirken können, solange noch kein Arbeitsverhältnis besteht.
Wo bleibt die Solidarität?
Solidarische Gegenwehr kommt inzwischen vonseiten des Ensemble-Netzwerks, eines 2015 gegründeten Vereins von Kulturschaffenden, der sich das Motto „Kultur braucht Lobby“ auf die Fahnen geschrieben hat. Auf dieses Netzwerk blickt Elisa mit Zuversicht, auch wenn sich bisher keine handfeste Protestbewegung gegen den kulturellen Shutdown formiert hat. In Frankreich, wo etwa in Paris bereits Theater besetzt wurden, um gegen den Lockdown zu protestieren und Arbeitslosengeld einzufordern, läuft das etwas anders. Dass der Protest in Deutschland vergleichsweise verhalten ausfällt, liege wohl in der politischen Kultur begründet.
Am Ausmaß des politischen Versagens kann es kaum liegen, so viel ist sicher. Die Bundes- und Landesregierungen begnügen sich nicht nur mit Symbolpolitik gegenüber der Kulturszene, sondern haben auch die langfristige Planung für substantielle Maßnahmen versäumt. Aber selbst unter Hygieneauflagen stattfindende Veranstaltungen könnten das, was die Erfahrung eines Theaterabends eigentlich ausmachen sollte, nicht ersetzen, so Elisa. Sie sehnt sich nach dem „Drumherum“, die Gespräche im Anschluss an eine Vorstellung bei einem Glas Wein, auf die es ankommt. Klar, mit Modellprojekten Normalität wiederherzustellen, ist da illusorisch. Und wenn ich hinzufügen darf: Wer will das schon – „Normalität“.
Raus aus der „Theaterblase“!
Als ich Elisa frage, ob sie denn eine baldige Neuauflage des Stücks „Zur Wartburg“ erwarte, in dem es um die gleichnamige Kultkneipe in Jena geht, macht sie sich – und mir – Hoffnung: zur nächsten Spielzeit, schätzt sie. „Aber jetzt wünsche ich dem Theaterhaus erst mal, dass sie überhaupt wieder spielen können,“ fügt sie mit Blick auf die im Juli anstehende Eröffnung der Kulturarena hinzu, die letztes Jahr abgesagt wurde. Der digitale Raum biete auf lange Sicht schlicht keinen Ersatz. Für manche Inszenierungen sei das geeignet, aber nicht für alle. Wenn, dann müsse man sie für den digitalen Raum speziell konzipieren.
Aber auch Open-Air-Theater lädt nur bestimmte Personengruppen ein, andere – oft unbewusst – schließt die Bühne immer aus. Deshalb setzt Elisa für ihre eigene Arbeit auf den öffentlichen Raum. Für das Wochenende am 25. und 26. Juni arbeitet sie an einem Happening auf dem Leipziger Marktplatz mit dem Titel „30 Stunden runder Tisch“, im Zuge dessen Texte aus der Frauenbewegung 1989/90 verlesen werden sollen. Die Performance zusammen mit Kollegin Tanja Krone und Freiwilligen aus Leipzig ist das Ergebnis von Recherche- und Arbeitsstipendien des Freistaates Sachsen und der Stadt Leipzig – auch ein Mittel der Existenzsicherung.
„Ich glaube an den öffentlichen Raum als Kunst- und Kulturplattform in diesem und dem kommenden Jahr,“ sagt Elisa, denn neben den offensichtlichen hygienischen Vorzügen einer Freiluftveranstaltung sei es „der partizipatorischste Ort“, ein Weg aus der „Theaterblase“. Besonders bei politischen Themen erwartet man sich selbstverständlich eine solche Reichweite. Die inhaltliche Auseinandersetzung begann mit Ina Merkels Text „Ohne Frauen ist kein Staat zu machen“, den Elisa selbst für die aktuelle Debatte um Rückschritte in der Geschlechtergerechtigkeit und die Wiederaufnahme alter Rollenbilder noch für aufschlussreich hält. Auch die Zeitzeuginnengespräche, die Elisa geführt hat, haben ein neues Licht auf die Gegenwart geworfen. Ihre Beschäftigung mit diesem Kapitel der Zeitgeschichte machte für sie die unabgeschlossenen Kämpfe von Feministinnen am Runden Tisch sichtbar und schuf ein Bewusstsein für Missstände, für die in der Zeit zwischen Mauerfall und Vereinigung die politischen Weichen gestellt wurden.
Gibt es ein Einlenken in der Krise?
Die Frage, was von Corona bleiben wird, beantwortet Elisa etwas optimistisch. Der Reflexionsprozess, der durch die Pandemie befördert wurde, was Theater eigentlich heißt und welche Rolle Kultur gesellschaftlich spielt, werde hoffentlich Früchte tragen. Damit meint sie Theaterhäuser mit überkommenen Hierarchien und unattraktiver inhaltlicher Ausrichtung, aber auch Politiker*innen, die die „krassen Systemfehler“ im Nexus zwischen Gesellschaft und Kulturbetrieben im Blick behalten sollen. Denn das Vorgehen vieler Kulturschaffender, für sich selbst das Bestmögliche herauszuschlagen, berühre die arbeits- und sozialpolitischen Kernprobleme nicht. Da brauche es engagierte Mandatsträger*innen und Bündnisse zwischen Politik und Gewerkschaft wie das Ensemble-Netzwerk, die eine solidarische Alternative zum vereinzelten Interessenskampf aufzeigen.
Mit der nun beschlossenen Änderung des Infektionsschutzgesetzes zeichnet sich allerdings zunächst ein Fortleben alter Prioritäten und Probleme ab. Der Deutsche Bühnenverein sprach sich daraufhin für einen „harten, konsequenten und schnellen Lockdown“ aus, forderte gleichzeitig aber Perspektiven für ein hygienisch verantwortungsvolles Kulturleben und bemängelte die fehlende Differenzierung zwischen Aufenthalten drinnen und draußen. Der „unternehmerischen Freiheit“ der Oligopole gilt realpolitisch weiterhin das Hauptaugenmerk – die Arbeit freier Künstler*innen schlägt in diesem Kalkül kaum zu Buche. Auch der bundeseinheitliche Beschluss also ein Ausweis von zweierlei Maß, wie Elisa im Anschluss an unser Gespräch betont. Bleibende Lehren aus Corona liegen wohl noch in weiter Ferne, solange selbst die laufende Krisenpolitik nichts als Verschlimmbesserungen bereithält.
(pj)
Richtigstellung: Die Ausfallhonorare werden anders als zuvor behauptet nicht über den Arbeitgeber, sondern direkt vom Bund bezogen. Auch enthielt eine frühere Version des Artikels die sachlich inkorrekte Aussage, das Recherchestipendium der sächsischen Kulturstiftung sei nur aufgrund einer Umwidmung von Projektgeldern zustande gekommen. Den Namen des Theaterhauses, das Elisa Ueberschär für seine arbeitsrechtlichen Praktiken kritisiert hat, haben wir auf ihre Bitte hin wieder entfernt.