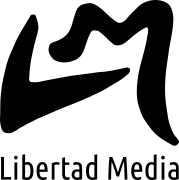Was verrät ein Buchrücken über ein Buch? Bild: Anastasiia Chepinska/Unsplash
Erstes Kapitel
In welchem berichtet wird, wie der junge Autor aus dem „Westen“ zur Literatur der DDR fand
Der erste Berührungspunkt mit ostdeutscher Literatur, an den ich mich erinnern kann, war der Schriftsteller Stefan Zweig. Wie das denn – Stefan Zweig? Der war doch Österreicher und ist noch dazu sieben Jahre vor der doppelten Staatsgründung gestorben! Nun, zugegebenermaßen war die Zweig-Anthologie Die unsichtbare Sammlung, die ich zwischen den Reader‘s-Digest-Groschenromanen eines Heidelberger Nachbarschaftstauschregals entdeckte, kein Herantasten an Literatur aus der DDR, sondern eine papiergewordene Rückschau in deren Verlagslandschaft.
Der etwas heruntergekommene Reclam-Band wirkte auf den ersten Blick so anders als die quietschgelben Taschenbücher, die ich aus der Schule kannte. Sicher ließ die Aufschrift UNIVERSAL-BIBLIOTHEK in Kombination mit der lieblos-bleiwüstigen Innengestaltung keinen Zweifel daran, dass es sich hier um einen Klassiker der Weltliteratur handelte, den jede Studentin aus gutem Hause einmal in möglichst engem Zeilenabstand gelesen haben sollte. Aber das Buch war für eine Reclam-Ausgabe dennoch ungewöhnlich groß, so dass es beinahe schon nicht mehr in die Hosentasche passte, und dazu noch mit schwarzem Cover – ein Stilbruch. Nun, alle Verlage machen wohl mal so eine rebellische Phase durch, muss ich damals gedacht haben, als ich das Buch einsteckte und mich, in meiner Studentenbude angekommen, in den Seiten von Zweigs „Episode aus der deutschen Inflation“ verlor.
Aber was mir rückblickend als klares Merkmal eines Leipziger Originals unter meinen antiquarischen Entdeckungen erscheinen will, ist der Buchrücken dieses schmalen Sammelbandes, auf dem der Autor als „St. Zweig“ ausgewiesen wird. Denn welchen vegetativen Namensvetter könnte er denn gehabt haben, von dem man ihn mit Verweis auf den Vornamen hätte abgrenzen müssen, wie man es auch dem armen Th. Mann antat? Es handelt sich hier um den Autor Arnold Zweig, der nach dem Exil in der DDR wirkte, dort viel breiter rezipiert wurde als im Westen und dessen Werk heute (man möchte hoffen, aus rein urheberrechtlichen Gründen) nicht mehr im „wiedervereinten“ Reclam-Sortiment zu finden ist.
Heidelberg, wo ich damals studiert habe und gelegentlich den städtischen Relikten der amerikanischen Besatzung nachspürte, lehrte mich das Stöbern in Antiquariaten lieben. Und als ich mich dort zu allem Übel auch noch politisierte, stillte ich meinen Lesedurst nach linker oder im weitesten Sinne humanistischer Literatur zu meiner eigenen Verwunderung immer wieder mit antiquarischen Büchern, die in der DDR verlegt worden waren. So erwarb ich zum Beispiel eine im Verlag Volk und Welt veröffentlichte Sammlung der Schriften Ernst Tollers, dieses vergessenen Revolutionärs und Kämpfers für ein sozialistisches Bayern (Moment, was?).
Die dicke, zweibändige Werkausgabe des Anarchisten Erich Mühsam, die auch mein Bücherregal in Jena noch ziert, stammt ebenfalls aus diesem Verlag. Wie passte das zusammen, war es der Zensur entgangen, dass Mühsam die falsche Art von links gewesen war, die anti-autoritäre Sorte? Natürlich nicht. Radikal staatskritische Texte des berüchtigten Revoluzzers aus der Weimarer Republik sucht man in den Ost-Ausgaben, ob beim Aufbau-Verlag oder bei Volk und Welt, vergebens. Jedes anarchistische Lüftchen, das durch Mühsams verbleibende, aber dennoch charakteristisch bissige Texte weht, musste der Herausgeber in einer marxistisch-leninistischen Endnote historisch „einordnen“, damit es überhaupt veröffentlicht werden konnte. Die SED wollte Mühsam nun einmal als Kommunisten und Antifaschisten erinnert wissen, seinen Anarchismus nachträglich als Irrweg abstrafen. Geht so die Rehabilitation der von den Nazis verbrannten Bücher, der von ihnen ermordeten Literatinnen und Freigeister?
Ähnlich ist es auch dem geheimnisvollen B. Traven ergangen, der unter diesem Pseudonym schon zur Weimarer Zeit proletarische Abenteuerromane verfasst hatte, die in der DDR wegen ihres sozialkritischen Inhalts massenhaft aufgelegt wurden. Von Travens Gesinnung musste man sich, weil eine „kritische“ Ausgabe allein zur Revidierung der anarchistischen Seitenhiebe seiner Charaktere wohl selbst den Herausgeber*innen zu peinlich gewesen wäre, zumindest im Klappentext distanzieren. So heißt es in einer Volk-und-Welt-Ausgabe des Romans Das Totenschiff von 1970 zum Beispiel, Traven
lernte (…) die Unterdrückung und Entwürdigung des Menschen so hassen, daß er mit der kapitalistischen Gesellschaftsordnung die ganze Welt verdammte und jede Form von Ordnung, von Staatsgewalt ablehnte. Von anarchistischen Positionen her forderte er schrankenlose Freiheit für den einzelnen. Manch einer, der früher begeistert und mitgerissen das „Totenschiff“ las, wird heute bei erneuter Lektüre mehr Abstand haben, kritisch wägen und Einwände anmelden. Aber er wird dennoch wieder gepackt werden von diesem Zeugnis grausiger kapitalistischer Wirklichkeit und tief empfundener Arbeitersolidarität.
So sympathisch mir die editorischen Leitlinien mancher Verlage im „Leseland DDR“ rückblickend auch sind, dem humanistischen Erbe der deutschen Literatur zu huldigen und antikolonialen Schriftstellerinnen aus Gründen der internationalen Solidarität eine breite Leserschaft zu verschaffen, kann ich nicht über die Verbrechen gegen die Menschlichkeit hinwegsehen, deren sich jede staatliche Zensur schuldig macht. So überraschte es mich vor ein paar Monaten auch wenig, zu erfahren, dass der Roman Ahasver des Dissidenten Stefan Heym, von dem ich zuvor eine „Erstausgabe“ aus dem Bücherregal eines Jenaer Gebrauchtmöbelhauses zutage befördert hatte, bereits sieben Jahre vor Erscheinen in der DDR im Westen veröffentlicht worden war, nämlich 1981 in München. Als ich den Roman las, erschrak ich wiederum regelrecht, dass dieses Buch in der DDR je vor 1989 erscheinen konnte, so unverblümt subversiv und verspielt ist die darin enthaltene Kritik an Antisemitismus, Dogmatismus und Grenzpolitik der SED-Diktatur. Dass sich die restriktive Kulturpolitik der DDR für die letztliche Publikation einer solchen Schrift bis 1988 genug gelockert haben könnte, war mir vorher als unmöglich erschienen. Ich hatte meine Wessi-Stereotype also doch noch nicht ganz überwunden. Wenn deren Aufarbeitung mir aber solche Freude bereiten kann wie die Lektüre von Heyms Buch, will ich diese gerne noch vertiefen.
Zweites Kapitel
In welchem der Autor endlich seine Rezension beginnt
Dieser Artikel ist nicht bloß eine Einladung, sich zusammen mit mir in den Gefilden ostdeutscher und DDR-verlegter Literatur auszutoben, wie ich es oben angedeutet habe. Er soll der Beginn eines Projekts sein, das sich den Anspruch, humanistische Literatur für die Gegenwart wiederzuentdecken, zu eigen macht. Dieses Mal ohne Honecker, die alte Spaßbremse, wie wär‘s? Es dürfen also auch die einen oder anderen Titel nicht fehlen, die im Osten kein Publikum fanden, ob aufgrund von Zensur, Zufall oder mangelndem Interesse. Da mir das nötige Startkapital fehlt, um einen Verlag zu gründen, der solche Bücher neu herausbringen könnte, und ich aus vertrauensvoller Quelle eines Heidelberger Altlinken und Übersetzers weiß, dass eine Verlagsgründung sowieso „die beste Art“ ist, „um Geld aus dem Fenster rauszuwerfen“, möchte ich dieses Projekt ganz bescheiden in einer Kolumne begehen. (Nächstes Mal dann auch in der gegebenen Kürze und Würze, versprochen.)
Ahasver soll mir als erstes Beispiel eines modernen Klassikers dienen, der unbedingt „wiederentdeckt“ gehört, besonders, wenn man auf der Suche nach radikalem Lesestoff ist. Denn oft sind die vergilbten Seiten solcher Bücher – und in dieser abgedroschenen Aussage werde ich mich selbst mit Konservativen einig – weitaus klüger als der gegenwärtige Zeitgeist. Da ist es zumindest sekundär, wenn nicht gar vollkommen irrelevant, ob sie nun in Ost oder West Ruhm erlangten; so viel habe ich inzwischen gelernt.
Nun denn: Was soll an Ahasver so toll sein, obwohl das politische Regime, gegen das Stefan Heym anschrieb, seit nunmehr 30 Jahren Geschichte ist? Eine zaghafte Antwort, die ich darauf geben kann, ist, dass sich das Buch nicht durch ein präzises Bild der damaligen Herrschaftsverhältnisse auszeichnet, sondern durch die Verbindungen, die es zu anderen Epochen und deren Obrigkeiten knüpft. Denn der eigentliche Stoff des Romans ist eine Erzählung, die Jahrhunderte weiter noch zurückreicht als die DDR, ja sogar als die sozialistische Idee. Es geht darin um die Legende vom „Ewigen Juden“.
Der Ewige Jude, auch Ahasver genannt, ist eine Figur aus dem Christentum (wenn auch nicht aus dem Neuen Testament), das der Geschichte von Jesu Leidensweg einen Nebenschauplatz hinzudichtet. Dieser Sage zufolge gedachte der verspottete, vom Tragen des schweren Kreuzes erschöpfte Messias-to-be, an der Tür eines jüdischen Schusters zu ruhen, der ihm die Rast jedoch verwehrte. Von dieser Absage schockiert, verdammte der (hier ausnahmsweise nicht so gütige) Jesus diesen Juden dazu, bis zu seiner Rückkehr und damit bis zum Jüngsten Gericht selber nicht ruhen zu können, also unsterblich auf der Erde zu wandern.
Seine Verbreitung unter anderem dem Luther-Schüler Paul von Eitzen verdankend, fand dieses Motiv über Jahrhunderte Einzug in antisemitische Erzählungen, die Jüdinnen entweder als vom christlichen Gott verdammte, bekehrungsunwillige Sturköpfe oder etwa als rastlose, keinem „Volkskörper“ je vollkommen zugehörige Rasse darstellten. Heute pflegt man als aufgeklärte Verschwörungsideologin lieber den Begriff „Kosmopoliten“: Es ist die nationale Ungebundenheit, das „Wandern“ zwischen Allianzen zur Durchsetzung anrüchiger Eigeninteressen, die diese vermeintliche globale Elite auszeichnen soll.
Aber statt diese Figur den Faschistinnen und Christen zu überlassen, stellt Stefan Heym in seinem Roman die provokante Frage: Was, wenn es ihn wirklich gäbe, den Ewigen Juden? Wie hätte er auf die Geschichte eingewirkt? Wessen Gesellschaft würde er heute pflegen? Aber mehr noch: Für Heym, der selbst als Jude aus Nazi-Deutschland vertrieben wurde, ist Ahasver nicht erst von Jesus verflucht worden, sondern bereits vom Gott des Alten Testaments; er ist ein streitlustiger Bruder des gefallenen Engels Luzifer, der sein ewiges Dasein auf Erden fristen muss, weil er sich während der Schöpfung Gott gegenüber weigerte, sich vor Adam, im Ebenbild Gottes geschaffen, zu verneigen:
Weswegen drängst du mich, o HErr? Ich werde den doch nicht verehren, der jünger und geringer ist als ich. Eh er geschaffen ward, ward ich geschaffen, er bewegt die Welt nicht, aber ich bewege sie, zum Ja und zum Nein, er ist Staub, aber ich bin Geist.
Luzifer pflichtet ihm bei und prophezeit, die Menschen würden sich mit ihrem Tun zu einem „Spott und Hohn“ auf das Bild Gottes entwickeln. Die Argumentation der beiden leuchtet auch einigen der anderen anwesenden Engel ein, aber nicht dem Schöpfer. Von ihm verstoßen, schwört Luzifer ihm Rache, Ahasver aber zeigt sich etwas wehmütig.
Daß du‘s nicht lassen kannst, sagt [Luzifer]. ER verstößt dich, aber du jammerst Ihm nach und Seinen Werken.
Alles ist veränderbar, sage ich.
Aber es ist so ermüdend, sagt er.
Und damit trennten wir uns, und er nahm seinen Weg und ich, Ahasver, was soviel heißt wie der Geliebte, den meinen.
Bezeichnenderweise ist die Überschrift dieses ersten Kapitels mit den Worten versehen: „In welchem berichtet wird, wie Gott zur Freude der Engel den Menschen erschuf, und zwei Revolutionäre in einer Grundsatzfrage verschiedener Meinung sind.“ Die ironische Spiegelung, die die Kapitelbeschreibungen auf das jeweils Folgende werfen, zieht sich durch das gesamte Buch hindurch. So begegnen wir dem jungen Theologen Eitzen, der während der Reformationszeit Bekanntschaft mit Ahasver macht, und dem Reb Joshua (die jüdische Bezeichnung für Jesus), wie er leibt und lebt und sich ebenfalls auf theologische Grundsatzdiskussionen mit dem Ahasver einlässt. Zwischendurch treffen wir auch auf einen gewissen Prof. Dr. Dr. h. c. Siegfried Beifuß am (von Heym erdachten) Institut für wissenschaftlichen Atheismus in Ost-Berlin. Dieser wird von einem israelischen Forscher an der Hebrew University in Jerusalem darauf hingewiesen, dass das Buch des deutschen Kollegen, Die bekanntesten judäo-christlichen Mythen im Lichte naturwissenschaftlicher und historischer Erkenntnisse, zwar von vortrefflicher Forschungsleistung in historisch-materialistischer Tradition zeugt, allerdings irrtümlicherweise suggeriert, der Ahasver existiere gar nicht. Dabei sei der ein alter Bekannter von ihm, dem Prof. Leuchtentrager aus Jerusalem. Er habe mit ihm damals das Grauen des Warschauer Ghettos durchstanden. Die beiden hielten noch gelegentlich Kontakt miteinander. Mit Verlaub, das kann nun aber wirklich nicht stimmen, meint der deutsche Kollege; das hieße ja, Jesus habe ihn tatsächlich verdammt und die Christen hätten Recht!
Dieser zwischen die biblischen und kirchlichen Schauplätze des Romans eingeschobene Briefverkehr gehört zu den satirischen Perlen von Heyms Roman, wobei er die Briefe der Akademiker ganz für sich sprechen lässt. Es kommt darin niemand zur Sprache außer den Protagonisten des Austauschs:
- Prof. Leuchtentrager, der in äußerst höflichem Ton anekdotisch und historisch die Existenz des Ewigen Juden verteidigt;
- der ostdeutsche Prof. Beifuß, der ihm mithilfe der wissenschaftlichen Rigorosität seines Forschungskollektivs und unter Wahrung derselben Umgangsformen die Absurdität dieser These beweisen möchte;
- und ein über alles wachender Herr Würzner, Hauptabteilungsleiter des Ministeriums für Hoch- und Fachschulwesen, der sich beim Durchsehen der Briefe, die unter anderem den Antisemitismus Martin Luthers thematisieren, um die ideologisch unbefleckte Austragung des „Luther-Jahres“ 1983 sorgt und wiederholt darauf pocht, der Genosse Beifuß möge doch bitte die Gelegenheit dieser Korrespondenz nutzen, um die imperialistische Rolle Israels in der internationalen Politik gegenüber dem Jerusalemer Kollegen anzuprangern.
Drittes Kapitel
In welchem der Autor endgültig vom Thema abdriftet, indem er die Frage behandelt, ob Jesus denn ein Revolutionär gewesen ist
Wer glaubt, dass die Figur des durch die Weltgeschichte wandernden Juden das Einzige sei, das die radikal unterschiedlichen Szenerien – vom Mythos zur Historie und wieder zurück – miteinander verbindet, der irrt sich gewaltig. Immer wieder ergeben sich Einfallstore für die Großen Fragen, die die Menschheit gerade in ihren Heiligen Schriften, aber eben auch in langwierigen akademischen Korrespondenzen zu erörtern versucht hat. In diesen Streifzügen durch die Ideengeschichte menschlicher Dogmen religiöser und atheistischer Natur ringt Heym mit einem Menschengeschlecht, das „das Lamm geschlachtet, aber das Opfer verworfen“ hat: das an seiner geschichtlichen Möglichkeit, eine wahrhaft menschliche Welt einzurichten, immer wieder scheitert. Wie lässt es sich nur erklären, „daß die lautesten Revolutionäre die strengsten Hüter der Ordnung werden“?
In Heyms anspielungsreicher Hommage an die christliche Legende ist Ahasver, der Unsterbliche, der eigentliche Humanist und Revolutionär: Er verstieß den erschöpften Reb Joshua einst nur von seiner Tür, nachdem dieser sein Angebot ausgeschlagen hatte, gegen die Verfolger das Schwert Gottes zu ziehen, um diese zu erschrecken. Er wollte dem gebeutelten Menschensohn so den Weg frei machen, um das Volk Israel zur Erlösung zu führen. Joshua aber weigerte sich, weil er den von Gott vorbestimmten Weg gehen wollte. Es ist dieser allzumenschliche Konservatismus in der Hoffnung auf Veränderung, die Kapitulation an die Vorsehung, die den Ewigen Juden in Wut versetzte. Aber das ist natürlich nicht mit überliefert. „Der Rabbi“, meint Ahasver später Eitzen gegenüber, hätte der Messias sein können, „so wie ein jeder, der geschaffen ist im Bilde Gottes, die Macht in sich trägt, ein Erlöser zu sein der Menschen“. Die Utopie lässt aber auf sich warten, Leid und Verfolgung sind immer noch an der Tagesordnung – Verfolgung durch Christinnen, Leid an den Händen derer, die ihre Feinde zu lieben vorgeben. Hier sind die Kapitel aus der Reformationszeit am bewegendsten. Die Resonanzen in die Gegenwart hinein sind zu vielfältig, um hier auch nur angerissen werden zu können. Sie reichen weit über das Christentum hinaus.
„Kein Schwert, entgegen dem Wort des Propheten, wurde je umgeschmiedet zur Pflugschar, kein Spieß zur Sichel geformt…“
Wie Ahasver Willen und Wirken des Menschen auf dem Weg zu seiner Befreiung von „gottgegebener“ Herrschaft heilig spricht, wie er dessen Verfehlungen moralisiert statt sie in geschichtlichen Gegebenheiten zu verorten, mutet geradezu anti-marxistisch an. Voluntaristischer Kitsch also? Utopischer Sozialismus? So wäre wohl das Urteil einer SED-treuen Zeitgenossin ausgefallen, die keinen Sinn für den spielerischen Umgang mit dem folkloristischen Erzählstoff hat, der das Buch so unterhaltsam macht. Aber auch als Parabel, als Meditation über Sinn und Wesen der Emanzipation ist der Roman unverzichtbar. Das marxistische Gerede von historischen Notwendigkeiten wirkt im Vergleich dazu eher protestantisch.
In einer denkwürdigen Unterredung ermahnt Ahasver den Reb Joshua: „Die Unvollkommenheit der Menschen ist die Ausrede einer jeden Revolution, die ihr Ziel nicht erreicht hat.“ Aber selbst derlei kämpferische Ansagen bleiben von Weltschmerz nicht ungetrübt. Er erinnert den Messias auch:
Kein Schwert, entgegen dem Wort des Propheten, wurde je umgeschmiedet zur Pflugschar, kein Spieß zur Sichel geformt; vielmehr nehmen sie die geheimen Kräfte im All und machen daraus himmelhohe Pilze aus Flamme und Rauch, in denen alles Lebendige zu Asche wird und zu einem Schatten an der Wand.
Dieser ernste, zugleich so freche Roman vermittelt, dass es heute wie damals, als man noch an sie glaubte, zumeist die gefallenen Engel sind, die auf dem Boden der Tatsachen stehen. Sie entlarven das Trugbild einer erlösten, im Fortschritt befindlichen Welt; sie sind ihr Gewissen. Und sie werden verdammt, weiter zu fallen, ins Bodenlose. Gerade das macht Ahasver so radikal, so weitsichtig selbst in Konfrontation mit der scheinbar unabänderlichen Grausamkeit der Gegenwart. Er leistet diese beinahe prophetische Arbeit aber, ohne sich selbst als Messias zu gerieren, denn sonst liefe er schließlich Gefahr, selbst zu einem Hüter der Ordnung „aufzusteigen“.
Man muss den Roman nicht didaktisch lesen, um zu erkennen, dass man es hier mit Literatur zu tun hat, die in einem emphatischen Sinne human ist – ohne auch nur im Geringsten dem sozialistischen Realismus verpflichtet zu sein oder je eine Antwort auf die „letzten Fragen“ zu geben. Im Westen sind diese freien Gedanken zuerst in den Druck gegangen, aber der Osten hat sie hervorgebracht. Ein eigentümliches Zusammenspiel. Als Stefan Heym am 4. November 1989 auf die Rednerinnenbühne der Alexanderplatz-Demonstration getreten war, sagte er: „Es ist, als habe einer die Fenster aufgestoßen nach all den Jahren der Stagnation, der geistigen, wirtschaftlichen, politischen.“ Auch in die Zeilen seines Romans vertieft, fühlte ich mich der geistigen Stagnation infolgedessen, was Linke heute liebevoll „die Gesamtscheiße“ nennen, für einen Moment entronnen. Eine Neuauflage ist 2018 im Penguin Verlag des Bertelsmann-Konzerns in München erschienen.
(pj)