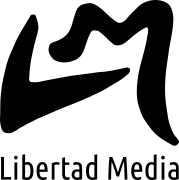Symbolbild: Irina Anastasiu/Pexels
Mit dem wuchtigen überregionalen Selbsterfahrungs-Theaterprojekt „Die mutige Mehrheit“ sind Antje Schupp, Necati Öziri und ihre Gäste übers Wochenende in Jena zu Besuch gewesen, wo sie in Kooperation mit dem Theaterhaus die städtische Veranstaltungsreihe „Kein Schlussstrich!“ zum Terrornetzwerk NSU fortsetzten. Unser Autor hat sich sieben der Panel-Veranstaltungen angehört.
Antje Schupps „Deutschkunde 2021“ ist ein Theaterprojekt, in dem es keine Schauspieler*innen gibt. Die Kritik an der Mehrheitsgesellschaft, die darin 10 Jahre nach Auffliegen des NSU erschallt, liegt weniger in der Performance als in der solidarischen Geste, das Jenaer Volksbad für ein zweitägiges Panel zur Bühne für Betroffene rassistischer Anfeindung und ihre Verbündeten zu machen.
Die Tagung, die am Wochenende einen Zwischenstopp in der Geburtsstadt des NSU machte, ist der zweite Teil eines von den Kurator*innen Schupp und Necati Öziri präsentierten Theaterprojekts mit dem Titel „Die mutige Mehrheit“. In der „Deutschkunde“ soll es darum gehen, „Deutsch zu verlernen“, Schupp nennt es augenzwinkernd das „Pflichtfach der Zukunft“. Stifte und Blöcke liegen für alle Menschen im Publikum auf ihren Plätzen bereit, neben der Bühne zeigt eine große Tafel den dichten Stundenplan: Vorträge, Podiumsdiskussionen, Workshops, eine künstlerische Performance. Das eigentliche Theaterstück entfaltet sich allein in der Konfrontation der Lernwilligen im Publikum mit der schrecklichen Realität, die die weiße Mehrheitsgesellschaft für die Hinterbliebenen des NSU darstellt: Es geht um Verfehlungen, Vertuschungen, blanke Ignoranz, die Wurzeln des Ganzen und mögliche Auswege aus der rassistischen Dauerkatastrophe. Der Lernprozess über die Hintergründe des NSU im Besonderen und des Rassismus im Allgemeinen soll ein Schritt sein, um von einer schweigenden zu einer „mutigen Mehrheit“ zu gelangen, so Schupp.
Postmigrantisch heißt auch postimperial
In seinem Eröffnungsvortrag spricht der Autor und Migrationsforscher Mark Terkessidis über „Saison- und ‚Gast’-Arbeit im Kontext des deutschen Imperialismus“ und schockiert mit der Feststellung, dass der Begriff der Gastarbeiter*in ursprünglich aus dem Vokabular des NS-Faschismus stammt und damals für „Fremdarbeiter“, also zumeist Zwangsarbeiter*innen aus dem Ausland gebraucht wurde. Terkessidis spannt den Bogen aber noch weiter: Die bis in die 70er Jahre gültigen Anwerbeverträge für ausländische Arbeitskräfte in der Bundesrepublik markierten ein vernachlässigtes Kapitel postkolonialer europäischer Geschichte, meint er. Ein Postkolonialismus, der auf die Beziehungen des Deutschen Reiches mit den Balkanstaaten, Griechenland und dem Osmanischen Reich im 19. und frühen 20. Jahrhundert zurückgehe. Wer den speziell auf Europa bezogenen Imperialismus Deutschlands allein in der Lebensraumpolitik des Dritten Reiches sehe, sei zu fokussiert auf die offen annexionistischen Bestrebungen deutscher Politik in den letzten zwei Jahrhunderten.
Hitlers Programm, sagt Terkessidis, bedeutete eine Rückkehr zu einem formellen Imperialismus, der sich im Kaiserreich vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs zunächst informell abgespielt hatte. Damals sollte durch moralisch-kulturelle sowie wirtschaftliche Durchdringung Mittel- und Südosteuropas ein deutsch dominierter Großraum in Europa geschaffen werden. Nachdem der erste Anlauf eines offen annexionistischen Kurses im Ersten Weltkrieg gescheitert war, besann man sich in der Weimarer Republik auf indirektere Mittel und entdeckte Deutsche im Ausland für sich als „Speerspitze moralischer Eroberung,“ so Terkessidis. Für das Überlegenheitsgefühl, das diese Eroberung motivierte, ließen sich bis heute Spuren im politischen Diskurs finden, stellt er fest, besonders in der rassistisch überladenen Reaktion der Medienöffentlichkeit auf die Eurokrise, die bekanntermaßen die Zerrfigur des faulen Griechen dem deutschen Volksspott preisgab.
Terkessidis macht mit diesen historischen Querverweisen deutlich, welche gewichtige Rolle der Faktor Arbeitskraft in der Pluralisierung einer Gesellschaft spielte, deren weiße Mehrheit bis heute mit Verweis auf ebendiese Arbeitsmigrationen vom Phantasma einer „Unterwanderung“, einer Rückkolonialisierung verfolgt wird. So von den Lippen führender Regierungspolitiker*innen abzulesen, die wahlweise Geflüchtete oder Menschen aus ehemaligen Arbeitsmigrantenfamilien ins Visier ihrer Hetze nehmen. Indem Horst Seehofer die Migration als „Mutter aller Probleme“ bezeichnete, so Terkessidis, habe er auch „Legitimation für die Gewalt an der Ostgrenze“ hergestellt, wo sich Neonazis erst kürzlich zur gewaltsamen Zurückdrängung Geflüchteter aus Belarus zusammengefunden haben.
„Die Pluralisierung ist umkehrbar“
Der Autor Max Czollek schließt an diese Darstellung an. Als Terkessidis‘ Folgeredner beklagt er, dass das Modell der „Integration“, das seit Jahrzehnten den mehrheitsdeutschen Umgang mit Migrant*innen bestimmt, der Realität einer postmigrantischen Gesellschaft nicht gerecht werde. Er wendet sich aber auch mahnend an die Jüd*innen und People of Colour, die er zu seinen Mitstreiter*innen zählt: Die Pluralisierung der deutschen Gesellschaft sei umkehrbar, das habe der Faschismus bewiesen. Die Tatsache, dass sich Institutionen allerorts gerne mit der „Vielfalt“ ihrer Belegschaft schmücken, könne darüber nicht hinwegtäuschen. Gerade die NSU-Morde, die vornehmlich an Kleinunternehmern verübt wurden, hätten klargemacht, dass Menschen mit Migrationsgeschichte nach Maßgabe der Volksgemeinschaft nur geduldet werden, wenn sie sich unterordnen: „Aufstieg ist nicht vorgesehen,“ lautet Czolleks erbittertes Urteil.
Ausgehend von dieser Kritik begründet der Dichter und Essayist ein Alternativmodell, das er „radical diversity“ nennt. Das Programm: gleiche soziale und materielle Teilhabe ungeachtet jeglicher „Integrationswilligkeit“, ein beherztes Fuck-you also an die Vorstellungshorizonte mordender Faschist*innen und assimilationsbesessener Konservativer gleichermaßen. Damit es der Idee radikaler Vielfalt gelingen kann, die politische Fantasie hierzulande zu erweitern, brauche es einen Rückgriff auf allzu oft „marginalisierte und domestizierte“ Erzählungen von deutscher Geschichte, in denen Jüd*innen und People of Colour bereits unter Beweis gestellt haben, dass diese Gesellschaft auf Vielfalt basiert, diese Vielfalt also weder ein Problem noch ein Accessoire darstellt. Die postmigrantische Gesellschaft bedeute nicht nur besseres Essen, so Czollek, sondern auch „mehr Liebe, mehr Wut und mehr Traurigkeit“ – Entwicklungen, die er hoffentlich allesamt für sein politisches Programm zu nutzen weiß.
„Das Nicht-Erinnern braucht viel Fantasie“
Im Anschluss an seinen Vortrag diskutiert Max Czollek mit der Autorin Mely Kiyak über die Sprache rund um den Terror des Nationalsozialistischen Untergrunds. Kiyak hat den NSU-Untersuchungsausschuss des Bundestages ab 2012 in einer Kolumne begleitet – eine bis heute prägende journalistische Erfahrung, wie man ihr im Gespräch anmerkt. War sie anfangs noch mit Erkenntnisinteresse in die Sitzungen gegangen, so drängte sich ihr allmählich der Eindruck auf, die stundenlangen Antworten, die die befragten Beamt*innen im Ausschuss lieferten, dienten letztlich nur dem Zweck, die polizeilich unbehelligten, durch den Verfassungsschutz geförderten Verbrechen des NSU-Netzwerks zu einer „bürokratischen Nichtigkeit“ zu erklären. Dieser Eindruck wurde begleitet von einer gewissen „Weinerlichkeit“ in den Aussagen der Beamten, sagt Kiyak, wenn zum Beispiel ein Verfassungsschützer die „menschliche Wärme“ seiner Abteilung und Vorgesetzten lobte, die ihm die Komplizenschaft seiner Behörde wohl besser zu verarbeiten erlaubte. (Nur einem deutschen Beamten könnte je das Kunststück gelingen, selbst die Mitmenschlichkeit noch zur Sekundärtugend zu reduzieren.)
Die Verschleierung habe sich aber nicht nur in Form von Abschweifungen abgespielt, sagt Kiyak, sondern sei bis in die sprachlichen Details zu beobachten gewesen. So wurde aus einem „Daran kann ich mich nicht erinnern“ etwa das entpersonalisierende Sprachungetüm „Das ist mir nicht erinnerlich“. Die Autorin hat einiges daraus gelernt, obwohl der Ausschuss seinen vorgeblichen Zweck verfehlt hat, die Morde aufzuarbeiten. „Das Nicht-Erinnern braucht ja viel Fantasie, und das hatten die alle,“ resümiert sie. Sie nennt die Auftritte der deutschen „Sicherheitselite“ deshalb „das größte Theaterstück, dem ich je beiwohnen durfte“. Czollek meint dazu:
Der Punkt, an dem sich Leute nicht absprechen, aber alle das Gleiche tun, würde ich als eine sehr gut funktionierende Ideologie, einen sehr gut funktionierenden Habitus bezeichnen.
Er ruft dem Publikum ins Gedächtnis, dass es sich bei den Auschwitz-Prozessen um historische „Ausnahmeprozesse“ gehandelt hat. Für die künstlerische Auseinandersetzung bleibt die Frage: Lassen sich solche politisch wie sprachlich abenteuerlichen Vorgänge überhaupt in einer Poetik des Widerstands aneignen? Die ausgebremste Aufarbeitung im Untersuchungsausschuss kann jedenfalls die Selbstverständlichkeit, die Sprache in der alltäglichen Kommunikation hat, verunsichern. Diese Verunsicherung, so scheint es, möchten Kiyak und Czollek in ihr widerständiges Schreiben zurücktragen. Kiyaks Misstrauen ist aber nicht nur im sprachlichen Umgang mit menschenfeindlicher Gewalt geschärft worden, sondern auch in Bezug auf die Verführung, sich einvernehmen zu lassen – selbst seitens der Opfer. „Schreiben, selber Denken, Erinnern ist Widerstand,“ lautet ihr Credo.
Forderungen an die Stadt
Die Entstehung des NSU aufzuarbeiten ruft aber mindestens genauso viel Kopfschütteln hervor wie sein für Staat und Öffentlichkeit unrühmliches Nachspiel. Die Recherchegruppe NSU Komplex Auflösen Jena hat sich schon seit Jahren zur Aufgabe gemacht, die unangenehmen Wahrheiten auszusprechen und die Saalestadt für ihren Umgang mit der rechten Szene in Jena in die Verantwortung zu nehmen. Deshalb haben sie nun einen umfangreichen Forderungskatalog entwickelt, der sich an die Verwaltung und den Stadtrat richtet. Die Gruppe verlangt darin unter anderem die „Anerkennung antifaschistischer/migrantischer Kämpfe“, die öffentliche Verurteilung der V-Personen-Praxis des Verfassungsschutzes und die Einrichtung eines „lokalen Dokumentations- und Bildungszentrums“. Und die öffentliche Bildung tut Not, um die zentrale Bedeutung staatlichen Wegschauens für die Verbrechen des NSU begreiflich zu machen. Zwei Vertreter*innen des Recherchekollektivs berichten unter anderem von einem Rohrbombenfund in den 90ern, der Hausdurchsuchungen beim späteren NSU-Kerntrio Uwe Böhnhardt, Uwe Mundlos und Beate Zschäpe zur Folge hatte. Das Ermittlungsverfahren wurde eingestellt, weil mit den Rohrbomben laut Behörden kein Anschlag geplant worden sei, und die drei versanken im Untergrund.
Es lohnt sich aber, bei der Aufarbeitung noch früher anzusetzen. Die Deutschkundigen vom Netzwerk NSU Komplex Auflösen schreiben dem Jugendtreff „Winzerclub“ in Winzerla eine wesentliche Mitschuld an der politischen Sozialisierung der Jenaer Neonazis zu. Das ist deshalb brisant, weil dieser Freiraum für junge Faschist*innen, bei dem auch der spätere NSU-Terrorist Uwe Mundlos ein und aus ging, Anfang der 90er Jahre unter den Augen des damaligen Jugenddezernenten der Stadt Stephan Dorschner entstand. Einen Grund für das Florieren der rechten Szene in Jena machen die Jenaer Antifaschist*innen in der „akzeptierenden Jugendarbeit“ der Straßensozialarbeiter*innen dieser Zeit aus. Der Aktivist Konrad Erben teilt dieses Urteil und liefert in seinem Beitrag einige wichtige Details zu dieser Praxis. Die Straßensozialarbeit der 90er Jahre verfolgte in Jena ein pädagogisches Konzept, das dem rechten Gedankengut der Jugendlichen nicht konfrontativ, sondern mit Offenheit begegnete. Das habe zugelassen, dass das Jugendangebot im Winzerclub die Opfer einer Gewaltatmosphäre, in der junge Migrant*innen und Alternative von Nazis drangsaliert wurden, faktisch ausschloss. Diesen Opfern bot die Junge Gemeinde Stadtmitte Unterschlupf, deren Pfarrer Lothar König die akzeptierende Jugendarbeit schon damals kritisierte.
Ob die Stadtverwaltung auch gewillt ist, „Deutsch zu verlernen“, indem sie sich der Problemanalyse und den Forderungen der Jenaer Aktivist*innen anschließt, ist fraglich. Der im Publikum sitzende Werkleiter von JenaKultur Jonas Zipf meldet sich in einer Fragerunde zu Wort und zeigt sich von den Vorschlägen angetan, wünscht sich aber mehr Beteiligung der Graswurzelstrukturen am städtischen Arbeitskreis. Nachhilfe also?
Hanau und der NSU: Die Stimmen der Angehörigen
Und was, wenn Kinder ihre deutschen Angewohnheiten gleich in der Schule verlernen dürften? Das Schicksal des NSU-Opfers Mehmet Kubaşik, der mit seiner Familie als kurdisch-alevitischer Geflüchteter nach Dortmund gekommen war und dort bis zu seiner Ermordung im Jahr 2006 als Einzelhändler arbeitete, ist dank seiner Tochter Gamze bereits Thema an einigen deutschen Schulen. Sie arbeite mit Schulklassen zusammen, erzählt sie im Volksbad, um die Geschichte ihrer Familie zu erzählen. Ihre Mutter Elif, die Witwe Mehmet Kubaşiks, hat dafür nicht die Kraft, ist aber an diesem Samstag auch nach Jena gereist, um das grausame Stück Zeitgeschichte, das ihre Familie durchlebt hat, im Forum der „Deutschkunde“ auszubreiten.
Was die Schüler*innen am meisten schockiere, erzählt Gamze Kubaşik, seien die Gerüchte über ihren Vater, die die Polizei nach dem Mord durch ihre Ermittlungsarbeit in der Nachbarschaft streute. Man wollte herausfinden, ob der Vater in Drogenhandel verwickelt war und brachte die Hinterbliebenen mit diesem „Verdacht“ in Verruf. Auch nach dem Auffliegen des NSU habe sich die Hoffnung auf einen engagierten Staat schnell verflüchtigt. „Meiner Meinung nach wollte das Oberlandesgericht München keine Aufklärung,“ sagt die Tochter. Es bleibt im Verborgenen, wer die Unterstützer*innen des Kerntrios genau waren, ob Mehmet Kubaşik ein Zufallsopfer gewesen ist und was der Staat von alledem genau gewusst hat. „Es gibt keine einzige Frage, von der ich sagen würde: Die ist geklärt,“ muss Gamze eingestehen. Der Gedanke, dass sie möglichen Helfer*innen in Dortmund heute vielleicht immer noch in der Stadt über den Weg läuft, ohne davon zu wissen, beschäftigte sie schon in dem Plädoyer, das sie zum Abschluss der Gerichtsverhandlungen im Saal vorgetragen hatte und in der „Deutschkunde“ nun erneut verliest. Die Sorge schleppt sie bis heute mit sich herum. Dennoch hat sie sich mehr Hoffnung in eine Aufarbeitung bewahren können als ihre Mutter Elif, der der Gerichtsprozess jegliches Vertrauen genommen hat, wie sie selbst sagt, nicht nur in den Staat, sondern in das Gelingen der Aufarbeitung überhaupt.
Was ich mir vor allem wünsche, ist, dass sich solche Morde nicht wiederholen.
Das teilt die Witwe über ihre Übersetzerin dem Publikum mit. Die Hoffnung ist getrübt von der bisherigen Erfahrung mit den deutschen Ermittlungsbehörden, die die Familie in die Nähe des Verbrechens rückten, indem sie eine Mitschuld des Opfers voraussetzten, anstatt die Hinterbliebenen vor einem weiteren Trauma zu bewahren.
Die Aktivist*innen der Initiative 19. Februar, welche sich nach dem Nazi-Anschlag in Hanau vor anderthalb Jahren gegründet hat, können ein Lied davon singen, wie struktureller Rassismus im deutschen Staat retraumatisieren kann. Im Volksbad sprechen sie am Sonntag, dem zweiten Tag der „Deutschkunde 2021“, über die Verschleierungsversuche der hessischen Behörden im Umgang mit dem Mord an neun Menschen, bei dem der Täter eine Shishabar zur Zielscheibe seines rassistischen Wahns machte. Zaghafte Veränderungen zumindest in der Medienrezeption habe es gegeben, stellt die langjährige antirassistische Aktivistin Newroz Duman fest, die sich nun bei der Initiative 19. Februar engagiert. So hätten die Opfer des Anschlags viel mehr im Mittelpunkt gestanden, als das sonst üblich sei. Mit dieser Entwicklung kann und wird sie sich aber nicht zufrieden geben: „Es darf nicht noch einmal alles unter den Teppich gekehrt werden,“ bekräftigt sie. Die Forderungen lauten: Erinnerung, Aufklärung, Gerechtigkeit, Konsequenzen. Bislang habe sich in allen Punkten eine „Kette des Versagens“ abgespielt, wie man sie aus der Zeit des NSU kenne, meinen die Vertreter*innen der Initiative. Dazu gehört auch, dass der Vater des Täters noch im Gericht rassistische Hetze über die Opfer verbreitete und bis heute eine Gefahr für die Hinterbliebenen darstellt.
Der Überlebende des Anschlags Piter Minnemann spricht von den Problemen, die jenseits des „Behördenversagens“ stehen. Dazu gehöre das weitgehend freie Agieren staatlich bekannter Neonazis, aber auch Alltagsrassismus – zwei „soziale Probleme, die in Deutschland gerne verschwiegen werden“. Der Täter von Hanau hatte sogar mit Selbstanzeigen auf seine mörderischen Absichten hingedeutet, die die Polizei aber nicht verfolgte. Auch einen Waffenschein konnte der psychisch kranke Faschist weiterhin tragen.
Newroz Duman möchte deshalb der Politik weiterhin „auf die Nerven gehen,“ sagt sie. Bislang werde vonseiten der Polizei „blockiert“, zum Beispiel in der Frage, wie es dazu kommen konnte, dass der 22-jährige Vili-Viorel Păun in der Mordnacht mehrmals die Polizei rief, aber nicht durchkam. Er verfolgte eigenhändig den Mörder mit seinem Auto und bezahlte dafür mit seinem Leben. Was ein von Duman nicht namentlich genannter CDU-Politiker den Eltern entgegnete, als er davon in einem Gespräch erfuhr, war nur: „Warum ist Ihr Sohn hinterhergefahren?“
„Es darf nicht bei Jahrestagen bleiben“
Ein weiterer Skandal, der sich am 19. Februar 2020 abspielte, war der Einsatz des Sondereinsatzkommandos (SEK) der Polizei. 13 der SEK-Einsatzkräfte, die zum Haus des Täters kamen, waren Teil einer rechtsradikalen Chatgruppe im hessischen Polizeiapparat, stellte sich später heraus. Warum das Eindringen ins Haus Stunden brauchte und die Polizist*innen den Täter nur noch tot auffanden, könnte mit diesem politischen Hintergrund etwas zu tun haben. Es bleibt ungeklärt. „Alles, was passiert ist, war keine Selbstverständlichkeit, sondern immer ein Kampf,“ berichtet Duman. Sie ist deshalb in ihrer Unterstützung der Hinterbliebenen umso entschlossener:
Wenn wir daran erinnern, dann erinnern wir immer daran, warum es passierte.
Also steht im Zentrum dieser Arbeit auch, warum der Serienmord nicht verhindert wurde, obwohl der deutsche Staat dazu alle Mittel und nötigen Kenntnisse hatte – ähnlich wie beim NSU. Neben der Aufarbeitung ist für Piter Minnemann auch die Arbeit der Polizei ein Anliegen, die nicht im unmittelbaren Zusammenhang mit dem Anschlag, aber doch mit deren strukturellem Rassismus steht. Wenn er beobachtet, wie aufmerksam der Vater des Täters vor eventuellen Übergriffen geschützt werde, während Jugendliche mit Migrationshintergrund bei jeder Gelegenheit auf der Straße dem rassistischen Verdacht der Einsatzkräfte ausgeliefert sind, fragt er sich: „Wer schützt uns?“ Er hat viel Verständnis für die Skepsis der Jugend gegenüber der Polizei, erfährt sie in Hanau und anderswo doch immer wieder, wie der von der Mehrheitsgesellschaft verehrte „Freund und Helfer“ ihnen nur auf die Pelle rückt. „Ich glaube nicht, dass einer, wenn er ein Problem hat, da noch die Polizei ruft,“ sagt Minnemann. Was immer bisher an Maßnahmen ergriffen worden ist, um die Arbeit der Polizei zu überwachen, hält er für „Augenwischerei“. Es gebe zwar auch gute Polizist*innen, meint er, diese zeichneten sich aber im Zweifel auch dadurch aus, dass sie die schlechten deckten, sobald es für sie ernst wird.
Für Newroz Duman steht fest: „Es darf nicht bei Jahrestagen bleiben. Es ist eine kontinuierliche Arbeit.“ Eine Arbeit, mit der eine auf Spenden angewiesene Graswurzelinitiative wie ihre nur schwerlich allein betraut werden könnte. Sie fordert daher, dass „Räume, die mehr Ressourcen haben, ihre Türen öffnen.“ Wenn man den Wunsch auf Jena übertragen möchte, entspricht er der Forderung von NSU Komplex Auflösen, dass die Saalestadt selbstorganisierte migrantische Gruppen mit mehr öffentlichen Geldern unterstützen und ihnen Räume zur Verfügung stellen muss, wenn es ihr mit der Bekämpfung von Rassismus ernst ist.
Wirklich „kein Schlussstrich“?
Mit dem Mammutprojekt „Deutschkunde 2021“ haben Antje Schupp und Necati Öziri ein Forum geschaffen, das der Kritik von Konrad Erben und anderen Rechnung trägt, bei der Veranstaltungsreihe „Kein Schlussstrich!“ doch bitte mehr Menschen zu Wort kommen zu lassen, die selbst von Rassismus betroffen sind. Zudem hat das von JenaKultur und dem Theaterhaus mitgetragene Projekt politische Anstöße für Jena geliefert, mit dem schändlichen Erbe als Geburtsstadt des NSU-Terrornetzwerks angemessener umzugehen. Nicht zuletzt der Besuch der Initiative 19. Februar hat gezeigt, welchen Hebel eine Kommune bei dieser Arbeit hat: Die Vertreter*innen lobten die Stadt Hanau in höchsten Tönen für deren Hilfe etwa bei der Einrichtung von Gedenkorten. Ganz im Gegensatz zum Land Hessen, das höchstens mit dem im November startenden Untersuchungsausschuss ein paar seiner Fehler ausbügeln kann – vorausgesetzt, dass sich das Trauerspiel von München dort nicht wiederholt.
Leerstellen im liberalen Antirassismus
Ganz persönlich gesprochen: Ich habe an diesem Wochenende viel Deutsch verlernt. Ein Versäumnis aufseiten der Veranstalter*innen aber bleibt, meine ich. So hätte Mark Terkessidis‘ Vortrag über den „postimperialen Arbeitsmarkt“ der Startschuss zu einer tiefer bohrenden Auseinandersetzung mit der NS-NSU-Traditionslinie in Deutschland sein können: eine, die auch den Nutzen des Rassismus für den deutschen Staat, das deutsche Kapital und Teile der weißen Mehrheitsgesellschaft zu kritisieren erlaubt, also danach fragt, welche manifesten Vorteile er für den Erhalt des Status quo hat. Leider behandelte das Panel das Phänomen des Rassismus fast ausschließlich isoliert von den Funktionen, die es gesellschaftlich einnimmt. Als Mittel zur Abwertung und Überausbeutung ausländischer Arbeitskraft oder als Blitzableiter für soziale Verwerfungen, deren Klassencharakter so verdeckt bleibt, kam es fast gar nicht vor.
Den antirassistischen Initiativen und von Rassismus betroffenen Menschen, die zum Panel geladen waren, kann man diese Lücke nicht zum Vorwurf machen, denn in deren Kämpfen für Aufarbeitung und öffentliches Gedenken lässt sich zweifellos eine Menge erreichen – und muss eine Menge geschehen. Ihren Stimmen haben wir es zu verdanken, dass es in den letzten Jahren hierzulande deutlich schwerer geworden ist, Rassismus kleinzureden. Das Vernachlässigen seiner Funktionen stellt allerdings einen Konstruktionsfehler in der Idee einer kommenden „mutigen Mehrheit“ dar: Es wird sie in der Klassengesellschaft, und erst recht in der deutschen, nicht geben, solange Rassismus, Antisemitismus und Sozialdarwinismus als gängige Deutungsschablonen für ein Wirtschaftssystem herhalten müssen, das jedem Menschen ein Preisschild aufdrückt. Gerade deshalb möchte ich aber anerkennend schließen und den beiden Kurator*innen danken. Es ist ein kaum überschätzbares Gut, dass es in einer vom Faschismus ewig verführten, in Fragen des Alltagsrassismus beispiellos beratungsresistenten Gesellschaft wie unserer eine mutige Minderheit gibt, die sich ihren sturen Glauben an die Veränderbarkeit der weißen Mehrheit bewahrt hat. Mögen ihr die Bühnen von Nutzen sein.